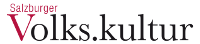

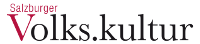

Die von Prof. Gottfried Steinbacher gesammelten und nachstehend abgedruckten biografischen Blitzlichter umfassen den Zeitraum der 1930er- bis zu den 1960er-Jahren. Er schrieb die Erinnerungen seiner Gewährsleute aus „innergebirg“ auf, um vergangene Lebensverhältnisse festzuhalten. Die Erzählungen handeln von Schneidern, Webern, Schustern, Schmieden, Wagnern und von anderen Handwerken. Die Auswahl, die Prof. Steinbacher getroffen hat, scheint auf den ersten Blick nostalgisch gefärbt. Es sind aber jene Dorf- oder Landhandwerke, die eng mit der vorindustriellen Agrargesellschaft verbunden waren und seit dem 19. Jahrhundert mit dem Ende derselben mehr und mehr verschwanden.[2975]
Die von Steinbachers Gewährsleuten beschriebenen Handwerksbetriebe hatten – speziell am Land – einige Gemeinsamkeiten. Dazu kann man ihre Größe, besser: ihre Kleinheit zählen. Sie waren Ein-Mann-Betriebe, manche mit einem Lehrling oder einem Gesellen. Die technische Ausstattung war sehr gering und die Handarbeit überwog. Man reparierte oder fertigte auf Bestellung neu an, was nicht immer in der eigenen Werkstatt, sondern auch direkt beim Auftraggeber – auf der Stör – geschah. In ihrer Struktur, Lokalisation und Arbeitsweise sind jene Betriebe die letzten Nachfahren der nicht zu einer Zunft gehörigen Störhandwerker, einer Arbeitsorganisation, die bis 1859 Bestand hatte. Sehr oft betrieb man eine kleine Landwirtschaft für die Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Sie produzierten ausschließlich für den lokalen Markt und deckten die alltäglichen Bedürfnisse der Landbevölkerung ab. So gehörte der Schmied zu den ältesten und verbreitetsten Landhandwerken. Einen Hufschmied gab es in jedem Dorf. Er war zuständig für die Ackerpferde der Bauern, denen er mehrmals im Jahr die Hufeisen erneuerte, das nachgewachsene Horn an den Hufen nachschnitt und wohl auch als „Viehdoktor“ fungierte. Er produzierte und reparierte Gerätschaften und Handwerkszeug aus Eisen. Zusammen mit dem Wagner war er zuständig für Pflüge, Eggen und Wägen. Der Wagner stellte die hölzernen Teile her, der Schmied beschlug die besonders beanspruchten Teile zum Schutz und für eine längere Lebensdauer mit Eisenblech und geschmiedetem Eisen.[2976] Der Schuster gehörte ebenfalls zu den wichtigsten Landhandwerken. Auch ihn traf man überall auf dem Land an. Das Reparieren und Flicken von Schuhen und Stiefeln machte einen umfangreichen Teil der Arbeit aus, aber am meisten war er mit Neuanfertigung beschäftigt, denn der Verschleiß an Schuhen war groß. Schuhe oder Stiefel gehörten (vereinzelt noch bis in die 1930er-Jahre) als Naturalanteil zum Einkommen der Dienstboten auf dem Land – zwei oder sogar drei Paar Schuhe gehörten zur Normalversorgung der männlichen und weiblichen Dienstboten auf den größeren Bauernhöfen.[2977]
Das Land Salzburg war sehr lange ein Agrarland. In dem größeren, gebirgigen Landesteil dominierte die Vieh- und in der Folge die Milchwirtschaft. Der Ackerbau im kleineren, flachen Landesteil war wesentlich geringer. Die statistischen Fakten um 1889 waren folgende: „Nur ein Siebentel der Bodenfläche Salzburgs ist sanftes Hügel- oder Flachland und gestattet eine intensivere Bodenbewirtschaftung; alles übrige ist Gebirge, in welchem nur die größeren Thäler, wie das 60 Kilometer lange Salzachthal, das Fuscher, Gasteiner, Enns- und Mur-Thal, die Ebene zwischen Wagrain und Radstadt, bei St. Johann und Werfen, dann der Saalfeldener Boden einen mit Graswuchs wechselnden Feldbau gestatten. Nichtsdestoweniger gehört die Hälfte der gesammten Bevölkerung (nahezu 90.000 Personen) dem Stande der Landwirthe an, welch letztere sich auf circa 15.000 Heimwesen vertheilen. Alle Besitzungen aber, ob groß oder klein, kennzeichnet die verhältnismäßig starke Dienstbotenhaltung. Auf je einer Wirthschaft werden im Flachland durchschnittlich 3, im Gebirge 8, ja in einzelnen Höfen sogar 20 bis 25 Dienstboten durch das ganze Jahr gehalten, deren Kosten um so bedeutender sind, als neben den gebotenen Sonn- und Feiertagen aus verschiedenen Anlässen und Gepflogenheiten noch weitere 36 Tage der Arbeit entzogen sind.“[2978]
Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten in den Dörfern und Kleinstädten viele Handwerksbetriebe mit einem breiten, auf die landwirtschaftliche Kundschaft abgestimmten Waren- bzw. Dienstleistungsangebot, das sich auch durch die 1859 erschienene Gewerbeordnung nicht wesentlich verändert hatte. So gab es beispielsweise 1868 in Kleinarl sechs Gewerbebetriebe, nämlich einen Krämer, einen Sägemüller, einen Schuster und drei Wirte; im Gewerbeverzeichnis von 1990 allerdings scheinen 40 Gewerbetreibende auf, davon der Großteil im Bereich des Fremdenverkehrs.[2979]
In der Marktgemeinde Saalfelden im Pinzgau gab es 1882 folgende 63 Gewerbe mit Befähigungsnachweis:
2 Apotheker,
2 Ärzte,
1 Nagelschmied,
2 sonstige Schmiede,
3 Schlosser,
1 Spengler,
1 Büchsenmacher,
2 Uhrmacher,
1 Lederer,
6 Schuhmacher,
2 Sattler,
2 Hutmacher,
4 Kleidermacher,
1 Seiler,
2 Weber,
3 Maurermeister,
1 Zimmermeister,
1 Wagner,
3 Tischler,
2 Fassbinder,
1 Färber,
1 Maler und Vergolder,
1 Hafner,
2 Glaser,
1 Kaminfeger,
1 Buchbinder,
1 Baumeister,
1 Friseur,
3 Bäcker,
1 Zuckerbäcker,
3 Müller,
1 Lebzelter und Wachspossierer,
2 Fleischhacker und Selcher,
2 Bierbräuer.
Auf dem Land saßen:
5 Schmiede,
2 Schuhmacher,
2 Kleidermacher,
1 Weber,
1 Maurermeister,
2 Zimmermeister,
2 Wagner,
1 Tischler,
1 Fassbinder,
14 Müller,
1 Fleischhauer und Selcher.
Dazu kamen noch im Markt:
1 Barbier,
2 Sägemüller,
1 Weißgerber,
1 Essigerzeuger,
1 Fischer,
1 Fotograf und
2 Fiaker/Lohnkutscher
Und auf dem Land:
1 Ziegelbrenner,
1 Ölbrenner/Stampfer,
4 Sägemüller und
1 Abdecker – alles Gewerbe, die ohne Befähigungsnachweis arbeiteten.[2980]
Die Berufe sind auf die Bedarfsdeckung des Marktes und seiner näheren Umgebung ausgerichtet. Die drei „modernen“ Gewerbe – der Friseur, der Fotograf und die Fiaker – deuten bereits auf eine neue Kundschaft, die Gäste, hin.[2981] Der seit Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich zunehmende Fremdenverkehr wird nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum wirtschaftlichen Leitsektor in dieser Region werden. Noch 1961/62, bei der Umfrage für den „Österreichischen Volkskundeatlas“, hatte Saalfelden 8.472 Einwohner, es gab noch bäuerliche Dienstboten und im Tourismus arbeiteten Einheimische und noch keine nicht aus der Region stammenden Saisonarbeiter.[2982]
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg begann sich allgemein eine nachhaltige Veränderung im Handwerk abzuzeichnen. Zunächst „traf es“ bestimmte produzierende Gewerbe wie Weberei, Färberei, Töpferei u. a., weil sie gegen die billigen und modischeren Fabrikswaren nicht konkurrieren konnten. Außerdem verbreiteten sich neue Essgewohnheiten und Tischsitten mit schönerem Geschirr; der Sparherd löste die offene Feuerstelle ab, die herkömmlichen Kochgeschirre aus Keramik waren unpraktisch geworden. Molkereien begannen die Milch einzusammeln und in ihren Räumen zu verarbeiten. Aus diesem Grund brauchte man auf den Höfen keine Keramik-Weitlinge und keine hölzernen Butterfässer mehr; auch alle anderen traditionellen Holzgefäße wurden allmählich von industriegefertigten Eimern und Kannen aus Metall abgelöst, die im Übrigen leichter und haltbarer waren. So verloren viele der herkömmlichen Landhandwerke ihren Absatz und mussten sich nach anderen Erwerbsmöglichkeiten umschauen, manche gaben auf, einige nahmen Handelswaren dazu bzw. verlegten sich ganz auf den Warenhandel, andere widmeten sich der Reparatur.[2983]
Die rasche Entwicklung und Verbreitung der Elektrizität löste die Abhängigkeit von der jahreszeitlich gebundenen Wasserkraft. Es entstanden neue Handwerksberufe. In der Marktgemeinde Saalfelden lässt sich diese Entwicklung beispielhaft verfolgen. „Durch die Einführung der Elektrizität und damit der elektrischen Beleuchtung in Saalfelden wurden zwar die Wachszieher stark eingeschränkt, dafür aber neue Berufe wie Elektroinstallateur, Maschinen- und Turbinenbauer neu geschaffen.[2984] Die neuen Berufe entstanden aus jenen Handwerken, die die passenden Voraussetzungen hatten. Die ersten Installationen führte der Schlosser aus; die ersten Turbinen errichteten Mühlen- und Sägebauern; die ersten Landmaschinen wurden vom Schmiedemeister und die ersten Näh- und Büromaschinen vom Instrumentenbauer verkauft und repariert.
Es ist nicht zufällig, dass die gesammelten Erinnerungen Steinbachers das Verschwinden der Landhandwerke spätestens um 1960 konstatieren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs änderten sich die Bedingungen wesentlich: Die Bewirtschaftung der Waren war weggefallen; durch den Krieg war ein enormer Nachholbedarf entstanden; die Gesetzgebung und die öffentliche Hand förderten die Wirtschaft stark. „Wiederaufbau“ und der Beginn der „Konsumgesellschaft“ führten zu einer starken wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung.
Sogar jene Handwerke, die eigentlich dem Strukturwandel bzw. der Industrialisierung schon längst zum Opfer gefallen wären, konnten sich in den ersten Nachkriegsjahren noch halten, weil die industrielle Massenanfertigung noch nicht voll angelaufen war und sehr viele Dinge repariert und von Hand angefertigt wurden. „So hatte man in unserer [in der Saalfeldener] Landwirtschaft Schafwolle, hatte eine Lodenfabrik und somit Arbeit für den Schneider. Man hatte aus unserer Landwirtschaft Tierhäute, hatte einen Gerber bzw. eine Lederfabrik und somit Arbeit für den Schuster.“[2985] Dazu kam in Salzburg auch die Bewusstseinsbildung für „traditionelles“ Handwerk und Tracht, die bereits ab 1909 mit der Heimatschutzbewegung, dann seit der NS-Zeit mit dem „Salzburger Heimatwerk“ und schließlich in der Nachkriegszeit mit der Wiedergewinnung eines Österreichbewusstseins betrieben wurde. Sie war von Anfang an eng mit Interessen des Tourismus verknüpft.
Ab den 50er-Jahren erlebte das Land Salzburg eine enorme wirtschaftliche Aufwärtsbewegung. „Von 1952 bis 1961 konnte das Land seinen Anteil am österreichischen BIP [Bruttoinlandsprodukt] um 11 Prozent ausdehnen und vollbrachte damit die höchste Wachstumsleistung unter allen [österreichischen] Bundesländern“.[2986] Diese dynamische Entwicklung ist allerdings im Land Salzburg entsprechend der inneren räumlichen Struktur des Landes unterschiedlich verlaufen. Im Zentralraum um die Landeshauptstadt Salzburg, der schon seit dem Mittelalter dominierte, wuchs die gewerblich-industrielle Verdichtung stark an[2987] während die Orte „innergebirg“, worauf sich die von Prof. Steinbacher gesammelten Erinnerungssplitter beziehen, die Ressource für einen wachsenden Fremdenverkehr darstellten.[2988] Die Landwirtschaft als Grundlage der alten Landhandwerke verringerte sich allerdings stark. 1869 waren knapp 70 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft tätig, 1900 noch 50 Prozent, 1951 22 Prozent und Ende des 20. Jahrhunderts nur noch 5 Prozent.[2989] Gleichzeitig stieg die Mechanisierung an. Der Pferdebestand in Österreich sank von 274.000 im Jahr 1946 auf 40.000 im Jahr 1980.[2990] Dagegen stieg die Zahl der eingesetzten Traktoren im Land Salzburg in den zehn Jahren von 1953 bis 1962 von 2.105 auf 8.481 an.[2991] Damit einher ging ein tiefgehender Strukturwandel, der alle Lebensbereiche betraf. Das Ende bzw. die Umstrukturierung der traditionellen Landhandwerke setzte endgültig ein. Die von Prof. Steinbacher gesammelten Erinnerungssplitter berichten davon.
Der Rückgang der ehemals weit verbreiteten Landhandwerke ist tatsächlich ein Indikator für Veränderungen. Er zeigt einen Wandel in der Wirtschaft und Landwirtschaft, im Konsumverhalten und in der Gesellschaft als Folge eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandels an, der mit der Industrialisierung begann und in eine weitere Phase führt, die in einer modernen Terminologie als „Tertiärisierung“ bezeichnet wird. Damit ist der seit dem 19. Jahrhundert einsetzende langfristige Übergang von der Agrargesellschaft (dem primären Wirtschaftssektor) über die Hochindustrialisierung (sekundärer Sektor) zur Dienstleistungsgesellschaft (tertiärer Sektor) gemeint.
„Die Industrielle Revolution verändert die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen sowie den Umwelt- und Raumbezug des Menschen so fundamental und tiefgreifend, dass der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft in der Geschichte der Menschheit nur noch mit dem Übergang von der Wildbeuter- zur Agrargesellschaft zu vergleichen ist. Während letzterer jedoch eine Zeitspanne von vielen Jahrhunderten bis hin zu einigen Jahrtausenden umfasst, breitet sich der durch die Industrielle Revolution ausgelöste Strukturwandel innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten aus. [...] Charakteristisch für die neue Struktur sind eine stark ausgeprägte Arbeitsteilung, der Einsatz von Wissenschaft und Technik und neue Energieformen. [...]“[2992]
Nicht überall drang die Industrialisierung mit gleicher Intensität und Radikalität vor. Der Alpenraum sperrte sich lange aus verschiedenen Gründen gegen eine frühe Industrialisierung, dennoch war er nicht ganz abgeschottet, Kenntnisse und Waren drangen ein, insbesondere ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Eisenbahn die Alpen verkehrsmäßig erschloss. Dies geschah zunächst nur entlang der Haupttäler, sodass die Folgen für die Landwirtschaft und das Gewerbe noch vergleichsweise gering blieben. Dennoch gerieten Heimindustrie, Handwerk und Kleingewerbe durch die billigeren Industrieprodukte, die durch die verbesserten Transportmöglichkeiten allmählich überall zu bekommen waren, stark unter Druck. Die völlige Erschließung der Alpen durch Autos, Lastkraftwagen und Busse fand aber erst nach dem Ersten und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg statt.[2993]
Dieser Prozess, der in Europa mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ablief, erfasste natürlich auch das Land Salzburg auf eine spezifische Weise.[2994] Hier blieb die Landwirtschaft überdurchschnittlich lange erhalten, da sich aufgrund der gegebenen topografischen Verhältnisse insbesondere die Schwerindustrie nicht ansiedeln konnte. Es entwickelte sich der industriell-gewerbliche Sektor auf klein- und mittelbetrieblicher Ebene in Verbindung mit dem Handels- und Dienstleistungssektor.[2995]
Vielen jungen Leuten in unserer Region des Fritz-, Lammer-, Enns- und Kleinarlertales – für die ich Ortschroniken verfasst habe – sind die alten Handwerksbetriebe nicht mehr bekannt, die hier seinerzeit in allen Dörfern und Märkten tätig waren. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es fast in allen Orten den Schneider, Schuster, Wagner, Huf- bzw. Zeugschmied und Müller, aber auch vielfach oder meistens noch einen Sattler, Säckler, Weber, Klampferer und Köhler. Es ist daher sicher für viele, besonders aber für die jüngere Generation interessant zu erfahren, wie diese Handwerker seinerzeit gelebt und gearbeitet haben. Aus den gesammelten Erzählungen soll nun in einer Zusammenfassung das Wichtigste daraus entnommen werden und den Älteren zur Erinnerung und den Jungen zum Kennenlernen dienen. Keine andere Generation hat eine so umfassende Änderung der Lebens- und Arbeitsbedingungen miterlebt wie die der heutigen Senioren. Es geht daher in den folgenden Beispielen darum, die Entwicklungen und Änderungen in den verschiedenen Berufen darzustellen, vor allem in solchen, die praktisch zu bestehen aufgehört haben. Der Zeitrahmen der Darstellung umfasst die Zeit zwischen 1920 und 1950.
Der Betrieb eines Schneiders auf dem Lande war bis ca. 1950 meistens ein Ein-Mann-Betrieb. Nur fallweise wurde ein Geselle beschäftigt. Der Schneider ist bei der Arbeit – außer an der Nähmaschine – fast immer auf dem Tisch gesessen, entweder im Türkensitz oder mit den Füßen auf dem Sessel, weil man dabei das zu bearbeitende Kleidungsstück besser überschauen konnte und dieses sauberer blieb. Es wurde noch sehr viel händisch genäht. Und dies, obwohl die erste Nähmaschine bereits zwischen 1790 und 1814 vom Tiroler Josef Madersperger (1768–1850) entwickelt worden war und seit 1846 amerikanische Nähmaschinen am Markt waren.[2996] Die Lehrzeit dauerte wie üblich drei Jahre und als Gesellenstück hatte man eine Hose, eine Weste und ein Sakko, alles bis zur ersten Anprobe herzustellen. Nach drei Gesellenjahren konnte man zur Meisterprüfung antreten, dabei war ein dreiteiliger Anzug von der „Abmaß“ über den Zuschnitt bis zur Anprobe anzufertigen.
Ein besonderes Problem waren vor 1950 die „Stacheleisen“ (eigentlich Staheleisen, Stagel, Stahel = Stahl, Bügeleisen mit zwei losen Stahlkernen zum Wechseln; es war das typische Bügeleisen der 1850er-Jahre). Der Stahel, also der Stahlkern, musste in der Feuerung des Küchenherdes erwärmt, mit einem Feuerhaken aus dem Ofen geholt, gut abgewischt und dann abgekühlt und eingesetzt werden. So konnte man immer mit einem Stahlkern bügeln, während der andere wieder erwärmt wurde. Sie waren nur kurze Zeit mit der richtigen Temperatur zu verwenden, dann erfolgte dieselbe Prozedur von vorne. Die Anfang der 1950er-Jahre bei uns erstmals verwendeten elektrischen Bügeleisen[2997] waren daher eine gewaltige Verbesserung, wenn auch einige noch keinen Thermostat hatten; diese musste man zur Temperaturregelung ein- und ausschalten. So sehen wir zwischen Stadt und Land hier zeitlich ungleiche Entwicklungen vor uns, denn die ländlichen Regionen hinkten der städtischen Entwicklung hinterher.[2998]
Früher war ein großer Unterschied zwischen einem Land- und einem Stadtschneider. Kam man zu einem erstklassigen Meister, sah man erst, wie ein richtiger Schneider arbeitete. Das ging aber nicht ohne viel Lehrgeld und so manchen Rüffel ab.
Bis etwa 1960 ging man in entlegenen Gebieten auch noch auf die Stör. Am Sonntag nach der Kirche kamen die Bauern und machten den Störtermin aus. Der Bauer hatte den Lodenstoff gegen eigene Wolle eingetauscht und bestellte nun für alle männlichen Hausbewohner Anzüge. Die Frauenkleider wurden von der „Nahterin“ angefertigt. Der Schneider musste mit Ausnahme des Lodens alles mitbringen, wie Futterstoff, Zwirn und Wattierung, Schere, Nadeln und dergleichen. Die Nähmaschine wurde vom Bauern mit dem Pferdewagen abgeholt. Nach der „Abmaß“ begann die Arbeit. Die Abmaß war nicht so genau, es wurde auch nach vorhandenen Kleidungsstücken Maß genommen. Die Arbeit bei größeren Bauern dauerte bis zu zwei Wochen. Man ging gerne auf die Stör, denn es war nicht nur für die Bauersleute, sondern auch für den Schneider eine Abwechslung des täglichen Einerleis. Die laufend notwendigen Anproben waren für die Kunden nicht so zeitaufwändig und der Störhandwerker sparte einerseits eine großzügigere Werkstatteinrichtung und wurde am Hof auch mitverpflegt. Der geringere Kundenstock am Land wurde nach einem meist seit Generationen bestehenden System der Wanderung bedient. Diese Form der Arbeit lohnte sich so lange, als für mehrere Personen auf einem Hof gleichzeitig gearbeitet werden konnte.
Abends wurde es meistens lustig, man spielte, tanzte und sang. Die Störarbeit wurde hauptsächlich in den Herbst- und Wintermonaten durchgeführt. Denn einerseits hätten die Kunden im Sommer selbst keine Zeit für nicht landwirtschaftliche Beschäftigungen gehabt und andererseits hatten auch die Störhandwerker oft einen kleinen landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Der Tag war kurz und der Abend lang und weil man bei der Petroleumbeleuchtung nicht weiterarbeiten konnte, war genügend Zeit für die Unterhaltung. War die Störarbeit bei einem Bauern in der Nähe, ging der Handwerker nach Hause schlafen, sonst übernachtete er beim Bauern. Nach 1960 kam immer mehr die Konfektion in den Handel und der Bedarf an Maßschneiderei ging stark zurück. Die älteren Schneider gingen in die Pension und die anderen mussten sich um einen neuen Erwerb umsehen.
Zu Großvaters Zeiten (ca. 1930) waren noch drei Söhne und ein Ziehsohn in der Schusterei Oppeneiger in St. Martin beschäftigt, Gesellen wurden fallweise, je nach Bedarf, angestellt. Neben der Schuhmacherei wurde auch noch eine kleine Landwirtschaft betrieben.
Die Schusterwerkstätte, ein Raum, befand sich im Wohnhaus des Bauerngütls. In diesem Raum waren zwei Steppmaschinen mit Handbetrieb, eine für die Herstellung der Schuhoberteile und eine für Reparaturen. An Werkzeugen wurden verwendet: das Kneip-Messer (ein flaches Eisen, vorne das dreieckige Messer mit der Schneide, der Handgriff war mit Leder umgeben; laut Schmeller, I/2, Sp. 1349, Kneif oder Kneip, ein kleines schlechtes Messer, wie es die Schuhmacher verwenden; dem engl. Wort knife verwandt), die Ahle (gebogenes Bohreisen), der Bohrer (Stahlspitz mit Handgriff), Hammer, Raspel und Feile. Das Drahtgarn wurde bis zu 16-fach zusammengedreht und mit dem Schusterpech eingelassen. In die Mitte dieses selbst angefertigten verstärkten Drahtgarnes kam ein Sauborsten und später ein ganz dünner Stahlfaden, damit das Einfädeln erleichtert war. Erzeugt wurden hauptsächlich Arbeitsschuhe mit Ledersohle, mit Holznägeln zusammengenagelt und mit Flügelnägeln beschlagen. Weiters Haferlschuhe (starke Halbschuhe) und die Goiserer, schwere, doppelt auf einen Rahmen genähte Arbeitsschuhe mit groben Flügelnägeln versehen oder einem Eisenbeschlag am Absatz, einem hufeisenähnlichen, halbrunden Eisenband und vorne an der Spitze mit einem Blechblatt. An den Sohlenaußenseiten des Schuhes waren Büffelnägel oder Mauskopfnägel angebracht. Diese Schuhe waren im 19. Jahrhundert in mehreren Betrieben in Bad Goisern/OÖ aus den bäuerlichen Schuhen zu berühmten Schi- und Wanderschuhen entwickelt worden. Mit ihrer internationalen Bekanntheit im Tourismus und Sport übertrug sich dieser Markenname auf den Schuhtypus. Einen gewerblichen Schuhhandel gab es damals im Fritztal nicht.
Weiters wurden sämtliche Reparaturarbeiten durchgeführt. Als Leder wurde hauptsächlich Rindsleder verwendet, Schweinsleder wurde nur als Zwischeneinlage und Schaf- und Ziegenleder als Futter verwendet. In der Regel wurden die von den Bauern bestellten Schuhe auf der Stör erzeugt. Nur wenn zwischendurch ein einzelnes Paar bestellt wurde, wurde dieses zu Hause in der Werkstätte gemacht. Zur besseren Abweisung der Nässe wurde von den Schweinen die Harnblase verwendet, diese wurde bei der Schlachtung entnommen, aufgeblasen, getrocknet und zwischen die Seitenteile der Schuhe eingenäht.
Wurde der Meister von einem Bauern verständigt, dass er eine bestimmte Menge und Art von Schuhen brauche, so ging es auf die Stör. Vorher ist der Handwerker zum Kunden gegangen und hat von den Hausleuten das Maß genommen. Das geschah mit einem zusammengefalteten Papierstreifen, in welchem die Maße eingerissen (als Riss-Zeichnung des Fußes) wurden und auf dem der Name verzeichnet war. (In St. Johann am Triebener Tauern, hatten alle älteren Bauersleute noch in den 1970er-Jahren ihre hölzernen Leisten beim Schuster liegen). Das Leder hatten die Bauern selbst und zwar im Eintausch gegen die aus der Hausschlachtung stammenden Häute, die im getrockneten Zustand am Kirchtag (Martinisonntag) beim Gerber eingetauscht wurden. Der Meister schnitt die notwendigen Lederteile für die herzustellenden Schuhe nach grobem Maß ab und zwar grobes Rindsleder (Rückenteile) für die Sohlen (ca. 1 cm stark), schwächeres Bauchleder für die Oberteile und Kalbsleder für feinere Teile. Dieses grob zugeschnittene Material nahm er im Rucksack mit nach Hause. Die Oberteile wurden dann in der Werkstatt zusammengesteppt. Die so vorgefertigten Teile wurden mit den Leisten, dem Werkzeug und dem übrigen Material im Rucksack zu den Bauern mitgenommen und am Bauernhof fertig gestellt. Das Sohlenleder wurde zuerst eingeweicht, um es geschmeidig zu machen, dann auf den Leisten aufgezogen. Bei großen Bauern waren ab und zu bis zu dreißig Paar Schuhe anzufertigen. Jeder Dienstbote und jedes Familienmitglied erhielt in der Regel jährlich ein Paar Arbeits- und ein Paar Feiertagsschuhe (in dieser Regelung lebte die alte Dienstbotenordnung fort, die verschiedene Naturalanteile der Bezahlung vorsah). Diese Arbeit dauerte bei einer Störgruppe von zwei bis drei Mann etwa eine Woche. Bei kleineren Bauern war die Störarbeit in zwei bis drei Tagen erledigt.
Beim Bauern erhielten die Störschuster Unterkunft und Verpflegung. Die Unterkunft und die Verpflegung waren auch nach 1945 noch teilweise sehr einfach und primitiv. Geschlafen wurde in der Mannerleutkammer auf Strohsäcken mit rupfenen Leintüchern und dem schweren „Werchgoita“ (Golter[2999] das sind Steppdecken mit Werch – d. i. der raue Abfall von der Leinwandbearbeitung – gefüllt, wie sie auch im 17. und 18. Jahrhundert in bäuerlichen Inventaren Salzburgs aufscheinen). Als Kopfpolster gab es die „Haferfleimpolster“ (Haferspelzenfüllung). Im Winter war es oft sehr kalt, geheizte Schlafkammern gab es nicht. Die alten hölzernen Bauernhäuser hatten meist undichte Wände und die schweren „Werchgoita“ wärmten auch nicht richtig. Die Verpflegung hing sehr von den Essens- und Kochgewohnheiten der Bauernfamilie ab. Meistens gab es die übliche Bauernkost wie Knödel mit Einlage aus geselchtem Rindfleisch, Krapfen, Farfel (geriebene oder „abgebröselte“ Mehlgerstel aus Wasser, Ei und Mehl, in Milch gekocht; eine Vorstufe der Nudeln) und zur Jause entweder Speck oder Käse aus der eigenen Erzeugung. Fleischspeisen gab es nicht. In manchen alten Bauernhöfen waren noch nach dem Zweiten Weltkrieg Rauchküchen mit festgestampftem Erdboden vorhanden. Die Sauberkeit ließ auch manchmal zu wünschen übrig. Einmal bekamen die Handwerker eine Farfel, auf der mehrere Fliegen schwammen, die haben sie übrig- bzw. stehengelassen. Die Dirn brachte die Farfel den Kindern und diese hörten sie dann die Farfel mit Genuss vertilgen. Sie selbst sind abends zum Nachbarn fensterln gegangen und haben dort ihren Hunger mit Speck gestillt.
Gar oft trafen die Störhandwerker in den Bauernhöfen auch geistig behinderte Kinder oder Erwachsene an. Die Ursache für die geistige Behinderung wurde von den Familien vielfach mit der Verabreichung des in Schnaps getunkten „Hadernzuzels“ (ein aus Stofflappen = Hadern selbst gedrehter und gebundener Kindersauger) an die Kleinkinder und dem übermäßig fettreichen Essen erklärt. In der Meinung, dass die Kinder bei viel Butter und Speck besonders stark werden würden, wurden sie manchmal geradezu gestopft wie die Gänse. Die Kinder hatten damals, ob Bub oder Mädel, nur Kittel an, eine Unterhose gab es nicht. Da passierte es schon, dass „herinnen hinausgegangen“ wurde und das Ergebnis auf dem Stubenboden lag.
Abends war es in manchen Bauernhöfen ganz lustig. Es wurden heitere Spiele[3000] wie „böhmisch Hackelziehen“, „Sterngucken“ oder „Schemelhupfen“ abgehalten. Beim böhmisch Hackelziehen legen sich zwei Burschen auf den Rücken nebeneinander und zwar so, dass sich der Kopf des einen am Fußende des anderen befand und man versuchte nun mit einem hochgehobenen Bein den Partner zu einer Rolle rückwärts zu zwingen. Wer den anderen zum Überschlag brachte, hatte gewonnen. Beim Sterngucken musste man in ein Rohr schauen und bekam dann Ruß oder Mehl entgegen geblasen. Beim Schemelhupfen wurden einem die Augen verbunden, man wurde auf einen Schemel gestellt und dieser dann von zwei Mann hochgehoben und hin- und herbewegt. Der mit verbundenen Augen auf dem Schemel Stehende musste zu Boden springen, hatte dabei aber kein Gefühl, wie hoch er vom Boden weg war und fiel dabei meistens auf die Nase, was mit Gelächter quittiert wurde. Manchmal gab es auch Tanz, wenn einer mit einer Zugharmonika oder mit dem „Fotzhobel“ (der Mundharmonika) dazu aufspielte.
Vielfach wurde abends auch noch ein Rosenkranz gebetet. Da mussten sich auch die Störleute beteiligen, niederknien und mitbeten. Als Licht gab es nur die Petroleumlampe. Um 1920 wurde deshalb während der Dämmerung, wegen des Zwielichtes, eine halbe Stunde die Arbeit unterbrochen. Das Gebiet, in welches wir (Oppeneiger) auf die Stör gegangen sind, lag zwischen Hüttau und Annaberg. Im Laufe eines Jahres waren wir etwa zwei Drittel der Zeit auf der Stör und ein Drittel zu Hause. Die Wege zu den Bauern mussten immer zu Fuß gemacht werden, nur entlang der Straße konnte man den Postautobus benützen. Den schweren Rucksack mit den vorgefertigten Oberteilen, dem Werkzeug und den übrigen Sachen musste man selbst tragen. Die Bezahlung der Störarbeit erfolgte selten nach Arbeitsabschluss, sondern meistens erst dann, wenn der Bauer das Holzgeld erhielt oder ein Stück Vieh verkauft hatte. Die Gesellen und Lehrlinge erhielten ab und zu von den Bauersleuten oder Dienstboten ein kleines Trinkgeld. Im Winter war der Weg zu den Bauern oft sehr beschwerlich, besonders wenn man bei starkem Schneefall oder Sturm die Wegstrecke hinter sich bringen musste. Schneepflüge gab es keine, höchstens dass der Bauer ein Stück Vieh entlang des Weges getrieben hat und man konnte in diesem Trog dann besser gehen. Ein paar Mal sind die Störschuster auch mit dem Störweber zusammengetroffen.
Ein besonderer Tag war der Sebastianitag[3001] (20. Jänner), der Tag des Schutzpatrons der Schuster und Schneider. An diesem Tag durfte nicht gearbeitet werden, sonst hieß es, bekäme man Abszesse am Hintern. In diesem inoffiziellen oder selbst auferlegten Arbeitsverbot findet sich ein Nachleben jener alten Handwerkerpatrozinien und -feiertage, die in Salzburg von Erzbischof Colloredo 1772/73 abgeschafft worden waren.
Anfang der 1950er-Jahre begann die Herstellung der Fabriksschuhe und auch auf dem Lande erfolgte der Verkauf derselben. In St. Martin eröffnete man im Ort, in einem gepachteten Lokal, ein Schuhgeschäft. Die Störarbeit wurde immer weniger, Mitte der 1960er-Jahre hörte sie ganz auf. Die Aufträge blieben aus, es musste in dieser Zeit bereits einem Nebenerwerb nachgegangen werden, um leben zu können. 1980 war dann endgültig Schluss mit der Schusterei Oppeneiger in St. Martin.
Dieser arbeitete noch bis Ende der 1960er-Jahre. Er starb 1971. Um die Arbeit des Wagners beschreiben zu können wurde daher ein anderer Meister, Franz Oberreiter, Hüttau, befragt. Dieser erzählt:
Während der Lehrzeit von 1948 bis 1951 wurde das Wagnergewerbe noch so ausgeübt wie zur Lehrzeit des Lehrherrn (1910er/20er-Jahre) und dieser erzählte, dass sich im Wesentlichen seit Jahrzehnten in der Arbeitsweise nicht viel geändert hatte. Der Lehrherr war in seiner Jugend noch ein richtiger Handwerksbursche, der von Meister zu Meister wanderte, er stammte aus Niederösterreich und ist, bevor er sich in Pfarrwerfen selbstständig machte, auf der „Walz“ im Missionshaus St. Rupert in Bischofshofen hängen geblieben.
Erzeugt wurden im Lehrbetrieb alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge, Geräte und Hilfsmittel wie: Heuwagen, Mistwagen, Goaßl (ein Schlitten bzw. Wagen, der hatte vorne eine Sitzbank und hinten eine Ladefläche), Blochwagen (Rungenwagen) für schwere Holztransporte, die beiden letztgenannten hatten eine Kurbelbremse. Dann gab es noch zwei Formen des Deichselwagens: den Krottenwagen mit Anze oder Deichsel, vorne ein Halbgestell, an dem mit einem Reitnagel der hintere Teil eingehängt war. Dieser Krottenwagen war mehr auf den steilen Bergbauernhöfen im Fritz- und Lammertal gebräuchlich, während man im Salzachtal mehr den Kipfenwagen hatte. Bei diesem war an dem Vordergestell ein Langwied (Dreieck mit Mittelstange) zum Verbinden des Vorder- und Hintergestells angebracht, auf welches entweder eine Leiter oder eine Brücke aufgelegt wurde. Je nachdem, was man liefern wollte, diente die Leiter zum Beispiel für Heu und die Brücke für den Mist. Neben den Wagen wurden noch Scheibtruhen (Schubkarren) und Radlböcke (größere einrädrige Schub- bzw. Schleifkarre) hergestellt. Diese hatten eisenbeschlagene Holzräder mit Speichen. Weiters wurden sämtliche Holzstiele für die landwirtschaftlichen Werkzeuge wie Schaufeln, Sappel (Sapin, Zugbeil), Hacken, Schiraggl (Schubstange zum Blochaufladen) und dergleichen angefertigt sowie Handleiterwagerl und Handbrückenwagerl.
Im Winter wurden Bockschlitten gemacht, diese waren aus einem Stück, zirka 3 Meter lang und 1,15 Meter breit, nicht teilbar und wurden zum Mistführen u. a. verwendet. Dann gab es den Sattelschlitten, entweder nur als Halbgestell zum Holzliefern (auf der Batz) verwendet oder als Vollschlitten mit Hinterteil, dieser war etwa 4 Meter lang. Die Ziacherschlitten (steuerbarer Zugschlitten) für die Holzknechte waren nur ein Halbgestell mit „Hörnern“ (den hochgebogenen Steuergriffen für den Fahrer) vorne und in leichter Ausführung, weil sie bergauf teilweise getragen werden mussten.
Weiters gab es noch den Langschlitten, einteilig, zum Streu- und Mistführen. Das Goaßl als Personenbeförderungsschlitten war besonders sauber und leicht ausgeführt, die Sitze waren erhöht angebracht. Für die Kinder, aber auch für Erwachsene, gab es noch den „Abreitschlitten“, ähnlich dem Langschlitten mit Hörnern vorne und später die Rodel mit Schnecken, das heißt, die Kufen führten in einem Bogen wieder zurück zum oberen Holm.
Der Wagner war auch Schierzeuger (Schi aus einem Stück Eschenholz) und Eisstockmacher. Als Rohmaterial wurde wintergeschlägertes Holz von der Buche, Esche (sie wurde als sehr wasserresistentes Holz für Geräte, Teller und Schüsseln verwendet) und Birke (ein festes, feinporiges Schnitzholz) verwendet, seltener auch Ahorn und Ulme. Ahorn wurde gerne als Schlittenkufenholz gebraucht, weil es auch ohne Eisenbeschlag gut auf dem Schnee lief. Die vom Wagner erzeugten Sachen wurden dann zum Schmied zum Beschlagen gebracht.
Die maschinelle Einrichtung eines Wagnerbetriebes bestand meistens aus einer mit Wasser betriebenen Turbine, die über die Transmission folgende Maschinen antrieb: Hobelmaschine, Bandsäge, Bohrmaschine und eine Drehbank. Zum „Bahen“ (Bähen, Erhitzen, Rösten), das ist die Biegung der Schlittenkufen, Skispitzen und dergleichen, war ein selbst angefertigter Holzkasten mit 3 x 0,5 x 0,5 Meter vorhanden. In diesen Kasten wurde das betreffende Holzstück eingespannt und durch selbst erzeugten Dampf aus einem Waschdämpfer erwärmt und erweicht, einige Stunden eingespannt gelassen, damit es die notwendige Krümmung erhielt, abgekühlt und dann eingebaut. Arbeit für den Wagner gab es immer genug, weil die Bauern ständig Ersatz für beschädigte oder kaputtgegangene Fahrzeuge und Geräte brauchten. Eine ständige Auseinandersetzung (im heiteren Sinn) gab es, weil die Bauern immer astreines Gerät haben wollten und man musste sie darauf hinweisen, dass man ja auch von den Bauern das Holz samt den Ästen kaufen musste.
Im Jahr 1956 wurden noch rund 100 Holzräder gemacht, doch bereits diese Erzeugung stellte eine auslaufende Produktion dar, denn diese Räder kamen nicht mehr zu Reparaturen in die Werkstatt zurück. Ende der 1950er-Jahre kamen die gummibereiften Eisenwagen auf. Die Wagenerzeugung verlagerte sich in die Fabrik. Schlitten blieben etwas länger im Programm. Durch den Bau der Forststraßen verlagerte sich der Holztransport auf die LKW- und Sommerlieferung. Damit wurde auch die Schlittenerzeugung immer weniger und eine schwere und gefährliche Transportart hatte ihr Ende gefunden. Mit dem Aufkommen der Traktoren wurde diese Entwicklung noch beschleunigt und die Wagnereibetriebe standen vor der Entscheidung, sich um eine andere Arbeit umsehen zu müssen.
Die alte Schmiede des Lehrbetriebes in Radstadt war um 1930 noch ganz nach dem alten Stil eingerichtet. Es gab weder Strom noch Wasserkraft. Der Blasebalg für die Esse musste mit dem Fuß betrieben werden und die Bohrmaschine war mit Handbetrieb versehen. Es gab dort noch keinen Federhammer, es musste alles handgeschmiedet werden – ein technischer Stand also, der eigentlich dem 19. Jahrhundert entspricht. An Werkzeugen waren vorhanden: Handhammer, Meißel mit Stiel, Rundstempel mit Stiel für die Anfertigung von Löchern, Feuerzangen in verschiedener Form und Größe wie Flachzangen, Hohlbacken- und andere -zangen, Amboss, Schraubstock, Gewindeschneidzeug, Beißzangen. An Hufbeschlagwerkzeug die Beschlagzange, Hauklinge, Holzschlegel, Rinnmesser, Beschlaghammer und Hufraspel. Die Hauptarbeit war das Beschlagen der vom Wagner angefertigten Wagen und Schlitten. Der Hufbeschlag wurde im Lehrbetrieb nur für Rösser vorgenommen. Der alte Lehrmeister starb 1932 und der Sohn hat dann 1933 elektrischen Strom eingeleitet, damit konnten der Blasebalg, die Bohrmaschine und die Schleifmaschine betrieben werden. Sonstige Schmiedewaren wurden im Lehrbetrieb nicht erzeugt.
Die Schmiede in St. Martin arbeitete mit Wasserkraft. Vom Wasserrad wurden über die Transmission ein Federhammer, das Gebläse für die Esse, die Bohrmaschine, die Schleifmaschine und ein großer Schleifstein angetrieben. Der Schleifstein diente zum Schärfen des eigenen Werkzeuges und der zur Reparatur eingebrachten Hacken. In den 1930er-Jahren wurden in dem Betrieb jährlich etwa 50 Pferde und zehn Ochsen beschlagen. Ausschlagende Pferde und Ochsen wurden am Fuß mit einem Seil angebunden, dieses Seil wurde durch einen an der Decke befindlichen Ring gezogen und angespannt. Dadurch standen die Tiere nur mehr auf drei Beinen und konnten nicht mehr ausschlagen. Bei den Pferden musste zuerst der nachgewachsene Hufteil abgeschnitten und geraspelt werden. Das Hufeisen wurde in der Esse erwärmt und in die richtige Passform gebracht, sodann auf den Huf kurz aufgebrannt. Nach der Abkühlung wurde das Hufeisen abgeschliffen und mit acht Nägeln am Huf befestigt. Dabei musste besonders aufgepasst werden, dass man nicht „ins Leben kam“, also in die schmerzempfindlichen Teile des Tieres.
Wenn der Huf ausgeschnitten war, sah man einen weißen Ring bzw. eine Linie. Außerhalb dieser weißen Linie war ein etwa acht bis zehn Millimeter starker Hufteil, in welchen man die Nägel einbringen konnte. Passte man nicht auf, so gab es eine direkte Vernagelung, die man an Schmerzzeichen des Pferdes sah und es kam Blut heraus. Bei der indirekten Vernagelung bemerkte man oft erst nach ein bis zwei Wochen den Fehler, wenn das Pferd zu lahmen begann. Dann musste das Hufeisen abgenommen und neu angepasst werden. Der Hufbeschlag erfolgte meistens an allen vier Hufen, nur wenn ein Eisen verloren ging, ersetzte man dieses. Bei den Ochsen war die Arbeit noch vorsichtiger durchzuführen, da diese ja nur Klauen hatten und die Klaue nur etwa 4 Millimeter stark ist. Da mussten acht Klaueneisen angefertigt und auf jeder Klaue mit zehn Nägeln befestigt werden. Ansonsten war die Arbeit gleich durchzuführen wie bei den Pferden.
Der Schlittenbeschlag bestand aus den Kufenschienen, den Winkelbändern und Zugbändern für die Verbindungen. Bei den „Ziacherschlitten“ und „Schloapfen“ (Zugschleifgerät) mussten auch die Tatztaschen (Angeln für die „Tatz“, das sind die Handbremsen) angebracht werden. Auf den Sattel (Öpö) kam ein Bandeisen mit einem Loch für den Reitnagel (bewegliches Gelenk), damit der Hinterteil der „Schloapf“ (Auflage für die zu schleifenden Baumstämme) am Halbschlitten befestigt wurde. Beim Wagenbeschlag brachte der Wagner zuerst die Naben der Räder an, an diese mussten die Nabenringe montiert werden, damit der Wagner die Speichen und den Außenring dazusetzen konnte. Am Außenring wurde dann die Eisenbereifung aufgezogen, die Büchsen wurden hineingemacht und an den Achsen mussten am Ende Blechbeschläge mit dem Loch für den Lohner (das ist ein Vorstecknagel, der oben breit geschmiedet war, damit er nicht durchfiel) vorgesehen werden. Der Lohner verhinderte, dass das Rad von der Achse herunterging. Die übrigen Beschlagarbeiten waren ähnlich wie bei den Schlitten.
Weiters wurden noch Vierkantsperrketten für die „Ziacherschlitten“ und die Schlagketten (ca. 1,5 m lang) für die Fuhrschlitten angefertigt. Die Ketten wurden bei steilen Wegstücken – als zusätzliche Bremsen – unter die Kufen eingelegt. Es gab dann noch Zeugschmiede, wie die beiden Winkler in Filzmoos und Pfarrwerfen. Letzterer arbeitete um 1980 noch in dieser Branche. Sie erzeugten Hacken, Sappel (Sapin), Schaufeln, Schiraggl, Spaltkeile für die Holzarbeit und Spalthämmer, Mistgabeln, Feld- und Schneehauen sowie Heumesser zum Schneiden der Heustöcke. An den Kirchtagen war immer einer mit seinen Waren vertreten.
Der Schmiedebetrieb wurde fast immer allein betrieben, zur Hilfe beim Hufbeschlag war meistens der Bauer oder sein Knecht dabei und für Arbeiten, wo man mehr Hilfe brauchte, musste ein Familienmitglied helfen. Jährlich wurden etwa 15 Heuwagen, fünf Mistwagen, 20 Ziacherschlitten und zehn Schloapfen beschlagen sowie größere und kleinere Ketten erzeugt. Zur Schmiede in St. Martin gehörte auch eine kleine Landwirtschaft mit zwei Kühen, zwei Schweinen und ein paar Hühnern. Damit war man Selbstversorger. Die Arbeit in der Lehrzeit begann um 6 Uhr früh und dauerte mit einer Stunde Mittagspause und je einer Viertelstunde für Vor- und Nachmittagsjause bis 18 Uhr. Urlaub gab es während der Lehrzeit keinen, die Bauernfeiertage wurden aber auch beim Schmied eingehalten.
In ganz wenigen Fällen waren bösartige Pferde zu beschlagen, dabei half man sich mit der so genannten Bremse. Das ist ein rundes Holzstück (Knittel) mit einer Seilschlinge, mit der man dem Pferd die Oberlippe eindrehte. Das ist sicherlich nicht tierfreundlich, aber es war in schwierigen Fällen notwendig. War man zu vertraut und arbeitete ohne diese Vorsichtsmaßnahme, so konnte es bei ausschlagenden Pferden zu schweren Verletzungen der Menschen kommen.
Ab Mitte der 1950er-Jahre begann die Zeit der Traktoren und der Rückgang des Pferdebestandes beschleunigte sich. Durch den Bau von Forststraßen und der Holzabfuhr mittels LKW wurden immer weniger Schlitten und Wagen gebraucht und der Arbeitsanfall dadurch immer geringer. Wer alt war, ging in Pension und die Jungen wurden Kunstschmiede.
Ein Schmied aus dem Ennspongau, Herr Winkler aus Filzmoos, der sich in den 1930er-Jahren des vorigen Jahrhunderts auf die Werkzeug- und Geräteherstellung für die Land- und Forstwirtschaft umgestellt und diese im ganzen Pongau angeboten hatte, erzählte dazu einige heitere Erlebnisse:
„In der wirtschaftlichen Notzeit der 1930er-Jahre war ich mit meinem Vater öfter mit dem Fahrrad auf Kundenwerbung unterwegs und wir kamen bis in den Lungau, aber auch ins Großarler Tal. Dabei ist mir eine Begebenheit in Erinnerung, die zeigt, dass damals unser Alpenraum zu den ökonomisch rückständigsten Gebieten in Europa zählte. Bei einer unserer Kundenwerbefahrten kamen wir zu einem Bergbauernhof im Großarler Tal. Von der gastfreundlichen Bäuerin wurden wir nach Abschluss des Verkaufsgespräches in die Küche des jahrhundertealten Bauernhauses zu einer Jause eingeladen. In der Küche befand sich auch, wie seinerzeit üblich, eine Hühnersteige. Die Hühner waren aber freigelassen und so saßen auch einige auf dem Küchentisch. Die Bäuerin verjagte sie und wischte die von den Hühnern auf dem Tisch zurückgelassenen Verdauungsrückstände mit ihrer Schürze ab. Bevor sie uns die Jause servierte, musste sie aber auch noch ein Kleinkind auf dem Tisch wickeln, wobei der kleine Bub in hohem Bogen auf den Tisch pinkelte. Auch das Ergebnis dieser Verdauungstätigkeit wurde von der Bäuerin mit der Schürze beseitigt. Anschließend brachte sie uns Butter und Brot. Mir war inzwischen der Appetit vergangen, während der Vater weniger Hemmungen zeigte und fest zulangte. Ich erzählte dies auch unserer wöchentlichen Saunarunde, was andere zu ähnlichen Erzählungen und zur Bestätigung meiner Aussage anregte.
So erzählte einer, dass er auch bei einem Bauernhof gerade zurechtkam, als die Bäuerin „Schupf-Nudei“ (dicke Nudeln aus Kartoffelteig, die einzeln zwischen den Handflächen gerollt werden) erzeugte. Der Vorgang dieser Nudelerzeugung ging so vor sich, dass die Bäuerin, am Sessel sitzend, ihren Kittel weit hochgeschürzt hatte und auf dem nackten Schenkel jeweils ein Teigkügelchen aus der Teigschüssel neben ihr nehmend, mit der flachen Hand zu einem kleinen Teigröllchen rollte und dieses in eine Schüssel zu ihren Füßen fallen ließ. Diese Nudeln wurden dann gesotten und anschließend in Fett herausgebacken.
Ein anderer wusste ein ähnliches Erlebnis vom alten Dr. Luchner aus Radstadt zu erzählen. Da ist einmal dieser Arzt, es war noch vor dem Zweiten Weltkrieg, zu einer Geburt auf einen hochgelegenen Bauernhof im Fritztal gerufen worden. Nachdem die Geburt bei der Magd gut vorübergegangen war, wurde er von der Bäuerin zu einer Jause eingeladen. Es wurden ihm ein Eierschmarren und ein „Schnapsei“ serviert. Bei der Zubereitung sah er, wie die Bäuerin eine scheinbar nie gereinigte, schwarze eiserne Pfanne nur kurz mit ihrer dreckigen Schürze auswischte, bevor sie die Eier einschlug. Aber auch das Schnapsglas zeigte wenig von Reinlichkeit. Um dem Verzehr auszukommen, schickte er die Bäuerin zum Nachschauen zur Wöchnerin und in der Zwischenzeit leerte er den Schnaps in einen Blumentopf und warf die Eierspeise schnell beim Fenster hinaus. Als die Bäuerin zurückkam, war sie erstaunt, dass der Doktor schon fertig gegessen hatte, meinte, er sei noch hungrig und bot noch etwas an. Als er dankend mit dem Hinweis auf seine Sättigung ablehnte, kam der Haushund bei der Tür herein und hatte den von ihm aus dem Fenster geschmissenen Eierkuchen, der ihm links und rechts der Lefzen herabhing, im Maul. Die Verabschiedung des Doktors ging dann schnell vor sich.“
Als Beispiel für die seinerzeit fast in allen Orten des Pongaues bestehenden Mühlen eine Erzählung des letzten Arlermüllers, Herrn Loitfellner:
Wie in den Hofkammerakten des Landgerichtes Wagrain zu finden ist, suchte ein Abraham Moosegger 1665 um die Genehmigung zur Errichtung einer Mautmühle (eine Lohnmühle) im Markt Wagrain an und erhielt am 19. September 1670 die Bewilligung dazu. Nachdem diese Mühle am Arlbach im Bereich des damals eng begrenzten Marktes zur Errichtung kam, ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es sich dabei um die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts betriebene Arlmühle handelte. In diese ursprüngliche Mautmühle brachten die Bauern ihr Getreide und hatten als Mahllohn zehn Prozent des Mahlgutes an den Müller abzutreten. Durch diese Naturalentlohnung kam der Müller in den Besitz einer größeren Menge Mehl, die er nicht selbst aufbrauchen, aber nicht verkaufen konnte. So entstand die mit dem Mautmühlrecht verbundene „Schwarzbäckerei“, das heißt, der Müller durfte aus dem zurückbehaltenen Mehl Brot backen, jedoch nur Schwarzbrot aus Roggenmehl, daher der Name „Schwarzbäckerei“.
Nun zum Betrieb des Müllers Loitfellner, wie er sich bis in die 1950er-Jahre abgespielt hat. Früher brachten alle Bauern, die nicht eine eigene „Gmachmühle“ (bäuerliche Hausmühle, die zu einem oder mehreren Bauernhöfen gehörte und nur dem Eigenbedarf, nicht der Lohnarbeit diente. Der Name leitet sich von jenem kleinen „Gemach“ ab, welches das Innere der Mühle bildete.) besaßen, ihr Getreide zu uns. War ein trockener Herbst, dann kamen auch die Gmachmühlenbesitzer zu uns, weil wegen des geringen Wasseranfalls die meist an Seitenbächen stehenden Gmachmühlen nicht betrieben werden konnten. Das Einzugsgebiet unserer Mühle reichte von Hinterkleinarl bis Rettenstein in St. Johann und bis zur Grenze der Gemeinde Flachau. Die Zufuhr des Getreides erfolgte durch die Bauern mit ihren eigenen Zugtieren (Pferde, Ochsen, Kühe) in Zweiradkarren, denn zu den Höfen gab es damals nur Karrenwege. Mehr als 100 bis 150 kg (das sind etwa 4 bis 6 Salzburger Metzen) konnten nicht aufgelegt werden. Die langen Anfahrtswege – für die weiter entfernt liegenden Bauern bedeutete das fast eine Tagesreise – verlangten eine genaue Festlegung für die Abholung des Mahlprodukts, denn man hätte es keinem Bauern zumuten können, umsonst den weiten Weg machen zu müssen. Trotzdem blieben zwei Leerfahrten, eine bei der ersten und eine bei der letzten Fahrt.
Das angelieferte Getreide wurde in Hohlmaßen (Metzen) aufgezeichnet, dann gewogen und ins Mahlbuch eingetragen. Ein Metzen Weizen wog ca. 28 bis 30 kg, ein Metzen Roggen 25 bis 27 kg. Wurde das Getreide trocken zur Mühle gebracht, betrug die Ausbeute ca. 75 Prozent Mehl, 20 bis 23 Prozent Kleie, der Rest entfiel auf die Staubung. Manches Mal brachte ein Bauer aber in seiner großen Not bereits kurz nach der Ernte schon sein Getreide zum Mahlen – es fehlte zu Hause bereits das Brot –, doch dieses noch feuchte Getreide ließ sich schwer mahlen und brachte höchstens eine Ausbeute von 40 Prozent. Nur auf besonderes Drängen wurden solche Aufträge übernommen, denn gerade die Schwächsten traf die geringe Ausbeute am härtesten.
Der Mahlvorgang wickelte sich im Normalfall folgendermaßen ab: Das trockene Getreide (Weizen) wurde vom Müller nochmals in der Putzmühle gereinigt (dabei die Spreu entfernt), dann in einen großen Netztrog (zum Benetzen mit Wasser) geschüttet und am Vortag des Mahltages mit Wasser bespritzt, damit es beim Mahlen durch die Reibungswärme nicht geröstet würde, wobei die richtige Dosierung vom Gefühl des Müllers abhing. Am darauffolgenden Tag kam das Getreide dann zum Mahlen. Mit Schaffeln wurde das Getreide aus dem Trog genommen und oben in die „Gosse“ (trichterförmige Einfüllöffnung) geschüttet, kam von dort nach unten zum Rüttelwerk (aus Holz) und durch die in der Mitte des oberen rotierenden Mahlsteines befindliche Öffnung auf den feststehenden unteren Mahlstein. Das Rüttelwerk erzeugte jenes Klappern, das im Lied „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach” besungen wird. Die Mahlsteine mussten von Zeit zu Zeit geschärft, das heißt mit einem spitzen und einem mit einer Krone versehenen Eisenhammer aufgeraut werden.
Vom feststehenden Mahlstein rann das geschrotete Produkt in den unterhalb befindlichen Raum in einen Zylinder (Beutelkasten) und wurde dort gesiebt. Dieses Sieben geschah in vier Phasen, zuerst ein ganz feines Sieb für feines Mehl, ein zweites für gröberes Mehl, ein drittes für Grieß und das vierte für Kleie. Der Rest wurde in ein Schaff geleitet und der Inhalt, der nicht gebrochene Teil des Getreides, neuerlich eingebracht bzw. aufgeschüttet. Wenn der erste Mahlvorgang vorbei war, zeigte ein eigens eingerichtetes Läutwerk an, dass wieder aufgeschüttet werden musste. Dieser Vorgang wiederholte sich vier- bis fünfmal, also so lange, bis kein Schrot mehr herauskam. Die verschiedenen Mahlsorten wurden dann in Säcke gefüllt.
Im Jahr 1939 wurde die alte Wagrainer Mühle umgebaut – die Wasserkraft als Antrieb wurde beibehalten –, die wichtigste Änderung dabei war, dass nun nicht mehr das Mahlgut mit Körperkraft zum neuen Mahlvorgang nach oben getragen werden musste, sondern dies ein Förderband (Elevator) besorgte. Dieser Umbau brachte eine wesentliche Erleichterung der Arbeit.
Ungefähr Anfang der 1950er-Jahre, nach der Elektrifizierung der Bauernhöfe, schafften sich viele Bauern elektrische Hausmühlen an. Dazu kamen das Ende der Lebensmittelbewirtschaftung, der Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft und der geringe Ernteertrag im Bergbauerngebiet, alles Gründe, den Getreideanbau einzustellen und damit war die Existenzgrundlage der Müllerei nicht mehr gegeben. Die Zulieferung von Mahlprodukten wurde immer weniger und so musste 1960/61 der Mühlbetrieb eingestellt und ebenso die mit dem Müllergewerbe verbundene Schwarzbäckerei aufgelassen werden. Der Backofen besteht zwar heute noch, wird aber nur mehr für den eigenen Bedarf verwendet. Um den Lebensunterhalt der Familie weiterhin zu gewährleisten, wurde dann zu dem bereits vorher bestandenen Landesproduktenhandel ein Brennstoffhandel angeschlossen. Das Wasserrecht für die Mühle, welches auch der Arlerschmied und der Arlerwagner benutzten, wurde aufgelassen. Damit hat ein seit Jahrhunderten bestandenes Gewerbe sein Ende gefunden.
Obwohl Häute, Felle und Leder in der heutigen Zeit durchaus von Bedeutung sind, kann man sich kaum vorstellen, welch eminente Rolle sie und die mit ihrer Verarbeitung befassten Gewerbe in der „Welt von gestern“ hatten. Dazu zählten die Gerber, Kürschner, Riemer, Sattler, Kummeter, Säckler, Taschner und Beutler.
Die Gerber übten ihre Tätigkeit entlang eines Gerinnes aus, weil dadurch der Antrieb der Lohstampfen und Walkfässer gegeben sowie reichlich Wasser für Schwemmen und Entsorgen gesichert war. Die Verschiedenheit der Gerbverfahren und die genau geregelte Abgrenzung der Produkte kam z. B. in der Stadt Salzburg auch in einer räumlichen Trennung zum Ausdruck, saßen doch die Rotgerber („Lederer“) in der Gegend der Lederergasse, die Weißgerber („Ircher“) hingegen vor dem Steintor. Alle jedenfalls weitab des Stadtkerns, da ihre Betriebe mit unangenehmen Gerüchen verbunden waren. Die Rot- oder Lohgerber erzeugten in pflanzlicher Gerbung aus Eichen- und Fichtenrinde (Lohe) große schwere Häute für Sattler und Schuster. Die Weißgerber produzierten in mineralischer Gerbung mit Salz und Alaun dünneres, edleres Bekleidungsleder aus Kalbs-, Schaf- und Ziegenfellen. Die Sämischgerber oder Ircher stellten durch Walken mit Fett oder Tran wasserdichtes Leder aus Schaf- und Ziegenhäuten her.[3002]
Die Rotgerber erlangten große Bedeutung angesichts der Vorliebe der Fürsten für ihre Marställe und der Verwendung der Pferde als bäuerliche Arbeitstiere, ebenso durch die Erzeugung des Leders für Schuhe, schwere Taschen und Werkzeuge.
Während der Sattler heute kaum den „Sattelbaum“, das Gerüst des Sattels, selbst herstellt, behäutet, beschlägt und grundiert, erzeugt er das Kummet zumeist noch vollständig. Dieses besteht aus einem Holzkern, der aus krumm gewachsenem Buchenholz zusammengefügt ist. Auf einem konisch geformten Holzbock, dem „Krummstock“, wird das Kummet aufgetrieben, bis es das gewünschte Maß vom Widerrist zum Brustbein erreicht hat. Beim „Zwienähen“ (der zweiseitigen Doppelnaht, die die Optik eines „Rückstiches“ ergibt) sind die stumpfen Sattlernadeln an den beiden Enden des Garnes, das aus Hanfschnur mit Pechüberzug besteht, eingefädelt. Als Halterung dient vor allem das „Nährössl“, eine Werkbank mit einer Schraubklemme; ist der Sattler auf der Stör, hat er nur eine derartige „Nähkluppe“ bei sich, allerdings an einem Standbein. Mit dem „Kummetschlägl“ erfolgt dann das Breitklopfen der mit Leder überzogenen Polsterung, dem so genannten „Kummetbauschen“. Beim Arbeitsgeschirr war in Salzburg für den Zug vierrädriger Lastwagen das Spitzkummet gebräuchlich.
Als Schmuckform des Halsbügels wird beim Zweispännigfahren für das vom Kutscher aus gesehen rechte Handpferd das „Dachshautkummet“ verwendet, bei dem ein präparierter Dachskopf auf die Spitze aufgesetzt ist und das Fell seitlich lose über eine als „Staubtuch“ oder „Weana Fetzn“ bezeichnete Webe herunterhängt; diese ist in Salzburg rot-schwarz, in der Steiermark z. B. grün-schwarz gestreift.
Neben dem Zaumzeug fertigt der Sattler auch alle anderen Riemen an, verziert ihre Ränder mit Zierstichen, schlägt mit blanken Nieten Muster ein, näht echte Kaurimuscheln an, reiht verschieden große Hängescheiben auf und montiert mannigfachen Messingzierrat, den er vom Metallgießer bezieht; zusätzlich ließen sich noch mit dem Reißeisen kontrastierende Muster in das Blankleder schneiden. Derartig geziertes Kummet- ebenso wie Brustblattgeschirr wurde (und wird) als Verbindung zwischen Zugtier und Fahrzeug hauptsächlich bei festlichen Anlässen verwendet und dokumentiert – immer blank geputzt und in der Sonne wie Goldknöpfe blitzend – den Stolz des Gespannbesitzers auf seine Rösser. Dies im Besonderen tun jene mit verschiedendst geformtem Messingbeschlag behängten Prahl- und Windriemen, die einst in Form schmaler Lederschnüre zur Fliegenabwehr gedient haben und in der Folge bis zu zehnt an einem gravierten Messingschild mit den Initialen des Bauern sowie dem Hofnamen hängen. Nicht minder eindrucksvoll sind die einst unheilwehrend gedachten und heute nach alten Modeln nachgegossenen Kummetkämme, deren Griffe früher symmetrisch waren und seit der Biedermeierzeit Motive aus der Welt des Pferdes aufweisen.
Die Sattlerei war früher ein Handwerk, das seinen Inhaber gut ernährte. Der Beruf wurde nicht nur als Auftragsarbeit zu Hause ausgeübt, sondern sehr häufig „auf der Stör“. Der Name „Stör“ kommt nach dem 32-bändigen Werk von Grimm davon, dass der Handwerker, der zum Bauern kam, einerseits die gewohnte Ordnung auf dem Bauernhof gestört hat und andererseits früher eine Arbeit außerhalb der Werkstätte betrieb. Störhandwerker waren nur außerhalb der Einflussbereiche der Zünfte zugelassen, sie waren meist auch nicht vollständig ausgebildete Handwerker. Nach dem Wörterbuch von Schmeller[3003] heißt stören seit dem 15. Jahrhundert Mühsal, Plage. Er nennt vier mögliche Ableitungen des Wortes: der mühevolle Broterwerb durch Lohnarbeit mit Kost und Quartier; die Störung der Familie des Dienstgebers; weiters die Störung der Handwerksordnung durch vagierende Handwerker; sowie das beständige Aufnehmen und Abbrechen des Gewerbes, nach der Salzburger Urkunde von 1409 (Codex latinus Monacensis, clm 15981), die von „stiften, stören, damit handeln tun und lassen“ spricht.
Die Störarbeit wurde im Schichtlohn abgerechnet, die Schicht dauerte von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Der Schichtlohn betrug um 1935 für den Meister S 4,–, für den Gesellen S 2,50 und den Lehrling S 1,50, dazu kamen noch die Verpflegung und Unterkunft. Früher hatten die Bauern durchwegs Pferde, doch auch für die als Zugtiere verwendeten Rinder (Stiere, Ochsen, Kühe) musste der Sattler das notwendige „Geschirr“ anfertigen. Auf die Stör gegangen wurde in der Umgebung von Schladming-Rohrmoos, Ramsau über Filzmoos, St. Martin, Lungötz, Wagrain, Flachau bis Werfenweng. Radstadt und Untertauern wurden vom Sattlermeister aus Radstadt betreut. Soweit es möglich war, fuhr man mit der Bahn, sonst ging man zu Fuß. Das notwendige Werkzeug wurde im Rucksack mitgetragen.
Der Sattler brauchte für seine Arbeit vorwiegend folgendes Werkzeug: Halbmond- und Viertelmond-Messer (Schlichtmonde oder Schabmesser), verschiedene Ahlen, Zirkel, Nähkluppe und Nährössl. Das Leder wurde großteils von den Bauern selbst beigestellt, manche Bauern haben auch noch selbst Leder gegerbt. Meistens wurde aber von den Bauern am Kirchtag das Leder von den Gerbern gegen die aus der Hausschlachtung stammenden Häute eingetauscht. Alle Waren, die wir zu Hause erzeugten, haben wir bei den Kirchtagen (Patroziniumsfesten) entweder in selbst mitgebrachten oder von der Gemeinde beigestellten „Staudeln“ (Ständen) feilgeboten. Die „Kirchtage“ besuchten wir in einem Umkreis bis Mauterndorf, Schladming, Wagrain, Hüttau, St. Martin, Filzmoos, ausnahmsweise auch manchmal bis Bischofshofen und Mühlbach. Nach Mauterndorf sind wir z. B. mit einem Pferdefuhrwerk um Mitternacht aufgebrochen, kamen gegen 7 Uhr früh in Mauterndorf an, dann wurde der Stand aufgebaut, bis 16 oder 17 Uhr wurde verkauft. Gleich anschließend wurde nach Abbau des Standels die Heimfahrt angetreten, gegen Mitternacht ist man wieder nach Hause gekommen. Eingekehrt wurde auf der Fahrt nicht, nur zu Mittag gab es in einem Gasthaus in Mauterndorf ein „Lüngerl“ oder eine Würstelsuppe. Eine Jause wurde von zu Hause mitgenommen. Sparsamkeit wurde damals großgeschrieben.
Ende des Zweiten Weltkrieges war die Sattlerei noch voll in Betrieb. Zwischen 1950 und 1960 kamen die Traktoren auf, der Pferdebestand ging rapid zurück, die Arbeit für die Sattler wurde immer weniger, man musste sich um eine andere Arbeit umschauen.
Die Säckler („lat. Bursarius, … jener Handwerker der in steiferem Leder als der Taschner und Beutler arbeitet, Ranzen, Felleisen, Coffer- und Stuhl-Überzüge und dergleichen macht“)[3004] gingen in Salzburg nach dem Ersten Weltkrieg zu Grunde, als es keine Beutel, Hosen, Unterwäsche und Taschen für das Militär mehr herzustellen gab. Auf dem Lande stellten sie in alten Zeiten auch die Mühlsäcke (Mühlbeutel) her, die während des Mahlvorgangs stark geschüttelt wurden und dabei am Boden streiften. Zum Schutz vor Abnützung wurden diese etwa zwei Drittel von unten herauf mit einem Lederbesatz versehen.
Ein Säckler aus dem Pongau (Altenmarkt) erzählt:
„Der Weg zum Urprodukt Leder war mir schon in der Wiege vorgezeichnet. Mein Großvater war bereits als Haut- und Fellhändler tätig und der Vater Rupert Scharfetter begann als Naturtalent, ohne eine entsprechende Ausbildung genossen zu haben, bereits 1942 mit der Anfertigung von Lederhosen. Zuerst war es eine Lederhose für mich, die er aus Sparsamkeitsgründen selbst anfertigte und die so gut gelang, dass Nachbarbuben auch so eine haben wollten. Auf diese Weise mehrten sich die Aufträge dafür. Weil Vater aber keine Gewerbeberechtigung für die Ausübung dieses Berufes besaß, gab es Anzeigen wegen Pfuscherei. Um dem auszuweichen, begann ich auf Wunsch des Vaters mit der Lehre bei einem Säcklermeister in Kitzbühel, legte die Gesellen- und Meisterprüfung ab und konnte 1954 nach einigen Berufsjahren in Kitzbühel, Mauterndorf und Salzburg, damals als jüngster Gewerbeinhaber dieses Berufsstandes im Land Salzburg, unsere Firma gründen.
Doch beginnen wir der Reihe nach. Meine Geburt fiel in die Zeit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre, mein Vater war Holzknecht und die Mutter Köchin beim Ennslehen im Flachauwinkel. Eine Heirat war erst 1939 möglich, wozu ein Ehestandsdarlehen die finanzielle Voraussetzung gab. Ich wuchs als lediges Kind einer Magd auf und hatte eine harte Kinderzeit als Lebensschule mitzumachen. Das Ennslehen liegt 8 Kilometer innerhalb von Flachau und bereits mit sechs Jahren hieß es, für den Schulbesuch um Dreiviertel 4 Uhr aufstehen, um sich nach dem Mehlkochfrühstück auf den Schulweg zu machen. Damals gab es keine geräumten Wege und Straßen, sondern wir mussten im Winter nach den Pferdestapfen die 8 Kilometer zur Schule gehen. Ausgefroren und müde kam man in der Schule an und manches Mal ist man dann in der warmen Schulstube eingeschlafen. Am Nachmittag war der Rückweg mit mehr als zwei Stunden eine weitere schwere Belastung. Heute kann man sich nicht mehr vorstellen, was es für einen sechsjährigen Schulanfänger bedeutete, diese Mühen auszuhalten. Bald nach der Eheschließung konnten die Eltern einen eigenen Haushalt gründen und kamen heraus nach Altenmarkt zum Hirschberg. Die harte Kindheit hat mir aber später sicher dabei geholfen, die Schwierigkeiten des Aufbaues eines eigenen Betriebes leichter zu bewältigen.
Mein Vater kam 1938 zur Alpverbesserung (Freihaltung der Weidefläche) und wurde als Wandergattersäger eingesetzt. Beim Bau einer Almhütte am Tauernpass zog er sich durch eine schwere Verkühlung ein Ischiasleiden zu und wurde nach einiger Zeit ausgesteuert[3005]. Um die Familie zu ernähren, begann er sich mit der Erzeugung von Strohpatschen, Taschen, Körben und dergleichen zu befassen. Dank seiner Geschicklichkeit bekam er genügend Aufträge, doch übte er seine Tätigkeit illegal aus und es kam wieder zu mehreren Anzeigen wegen Pfuscherei. Der Richter hatte jedoch Verständnis, dass Vater nur auf diese Art seine Familie durchbringen konnte und es gab mehr Verwarnungen als Strafen. 1953 trat ein neues Gesetz gegen das Pfuscherwesen in Kraft und damit kam das Ende. Die schwere Nähmaschine für die Säcklerei wurde beschlagnahmt. Erst 1954 konnte ich mit einer verminderten Gesellenzeit die Meisterprüfung ablegen, bekam auch noch Nachsicht vom Mindestalter von 24 Jahren für die Gewerbeberechtigung und war nun selbstständiger Säcklermeister. Damit konnte nun auch der Vater wieder unter meinem Namen im Betrieb arbeiten.
Die Säcklermeister sind eine kleine Fachgruppe der Wirtschaft und zu meiner Lehrzeit gab es nur in zwei Orten in Salzburg und zwar in St. Johann im Pongau und in der Stadt Salzburg (Jahn-Markl), solche. Die spezielle Verarbeitung von echtem Sämisch-Rotwildleder erfordert umfassende Sachkenntnis. Unter „Rotwild“-Leder versteht man nicht Hirschleder, sondern im Sommer erlegtes Wild (Reh, Gams, Hirsch). Es wird besonders geschätzt, da zu dieser Zeit die Poren am kleinsten sind. Die Säckler betreiben heute (seit etwa 1910 und bestimmt durch die damals aufkommende Trachtenmode) hauptsächlich die Maßanfertigung von Lederhosen aller Art, Herren-Oberbekleidung, Damenröcke und -kostüme, in gediegener, formbeständiger Handwerksarbeit aus ausgewähltem hochwertigem Wildleder. Dazu bietet der angeschlossene Handel gut abgestimmte Lodenjanker, Strickspenzer, Westen, Hirtenhemden, Kniebundstrümpfe usw.
Mit der Verarbeitung von Feinleder beschäftigen sich vornehmlich Säckler und Taschner. Im gegerbten Wildleder stören Narben von den Brunftkämpfen der Böcke, die „Waldrisse“, in keiner Weise, im Gegenteil, man bevorzugt sie, soll doch Kraft und Mut des Tieres auf den Träger der Hose übergehen. Das kommt auch im folgenden Vierzeiler zum Ausdruck:
„Den mecht i kenna,
der mia ebbas tat,
ja dem woschat i ’s Leda
und wixat eahm d’ Naht!”
Falls ein Schussloch enthalten ist, muss dieses kunstvoll geschlossen werden, indem die ursprünglich runde Öffnung randparallel geschnitten und das Leder vorsichtig gedehnt wird. Da sich die Nähte nicht überdecken, braucht man sie nicht wie normal über einem unterlegten Klopfholz mit der Windspindel weich schlagen, sondern es müssen die Ränder flach vernäht werden. Obwohl den Säcklern Salzburgs Erzbischof Guidobald Graf Thun im Jahr 1657 unter anderem das Recht bestätigte, „von samisch leder und mit alleley seiden gezierte strimpf, irchene Wams und handtschuech” machen zu dürfen, stellen heute die Lederschneider Herren-„joppen“ und Damenkostüme her und der Säckler bestickt nur diese Kleidungsstücke; die Lederhose nach Maß fertigt er aber noch selber an.
Beim ledernen Beinkleid sind seit alters her die Lang- und Kniebundhosen bekannt, dann die Gsasshosen, die der heutigen Lederhose die Rundnaht weitergaben, dazu Hosenschäfte und Schurze. Die gelben, weil ungefärbten Langhosen der bäuerlichen Tracht kamen im Laufe des 18. Jahrhunderts ab. Die kniekurze „Kurzlederne“ tauchte erst lang nach 1800 in Salzburg auf. Neben dem Bedarf der einheimischen Bevölkerung kamen in den 1960er- und 70er-Jahren vermehrt Aufträge von den Gästen des zunehmenden Fremdenverkehrs. Wenn die elterlichen Betriebe von den Nachkommen übernommen werden, so ist das Gewerbe des Säcklermeisters eines der wenigen, das auch in Zukunft weiter bestehen wird.
Zum Zuschneiden besitzt der Säckler eine Auswahl von Grundschnitten, die sich im Lauf der Zeit verändert haben, einmal weit und lang fallend, dann wieder kurz und knapp anliegend, hoch geschnitten oder tief sitzend. Für die vier Teile der Beinlinge benötigt er Leder mehrerer Tiere, weil sich das Material in einzelnen Richtungen verschieden verhält. Beim „Latz“, gemeinhin auch Hosentürl genannt und auf Grund seines früheren Fehlens oft Anlass für Kleidervorschriften, sind seitlich an die Schlitze breite, rund oder spitz zulaufende Leisten aufgesetzt. Der Kniebund wird mit Riemen oder Knöpfen zusammengehalten, doch es wird keine Schnalle verwendet. Lederstücke benötigt man noch für den Hosen- und Latzbund sowie für die kleine Messersackleiste. Die Taschen arbeitet der Säckler in die Seiten- und Bundnaht ein, wo sie am wenigsten auftragen.
Bei der schwarzen Hose der Festtagstracht (die Farbe „Altschwarz“ war für Kaiser Franz Joseph erfunden worden, wie Erwin Jahn-Markl in seinem Museum zeigt), aus Sämischleder von Hirsch, Reh oder Gams, ist charakteristisch für Salzburg, aber auch Ostbayern und das Innviertel, die Tellernaht am Gesäß, auch „Spiegel“ wie bei Tieren genannt, was nach Karl Heinrich Waggerl „aussieht, wie wenn eine Schnecke herumgegangen wäre“. Diese Rundform betonen helle Schnittflächen an der knapp beschnittenen Außennaht, ja man verziert noch an der Kreuzung zwischen Mittel- und Tellernaht doppelt symmetrisch mit einem als „Springer“ bezeichneten Ornament. Dieses ist, wie alle Reliefstickereien, typisch für Salzburg und Tirol, mit weißfarbener Perlseide, am schönsten mit echtem Hanffaden ausgeführt, während solch eine Ausnäharbeit im Salzkammergut, in der Steiermark und in Bayern – dort allerdings in flächenfüllender Plattstickerei – in Grün üblich ist.
Vorlagen für die „Blumen“ genannten figuralen Verzierungen, bei denen in Salzburg neben naturalistischen Tierdarstellungen vor allem seit dem 18. Jahrhundert unveränderte Pflanzenmotive angewendet werden, befinden sich zumeist seit Generationen im Firmenbesitz. Frei wird dagegen die Auszier an den Nähten in Stepp-, Hinter- oder „Kederstich“ (Rückstich) gestickt. Die perforierte Schablone legt der Säckler auf das Leder und bürstet entweder geschabten Kreidestaub durch die Löcher oder überträgt durch Schummern[3006] mit dem Reibbein das Muster auf den Untergrund. Den losen Kreidestaub muss man dann mit Hilfe eines Gänsekieles mit Gummi arabicum fixieren. Beim Ausnähen des Musters können entweder mit der Nähmaschine einfache Bogen und Geraden vertikal gesteppt oder kompliziertere Formen mit der Hand mit Hilfe des „Nähringes“, einer Art Fingerhut ohne Kappe, flach eingezogen werden. Auch die Stickereistreifen, die parallel zu den Seitennähten verlaufen und nach deren Anzahl der Kenner eine Hose bewertet, kann man teils maschinell, teils händisch herstellen und dabei Motive wie „S-Laub“, „Hirschgeweih“ oder „Schlangerl“ mehrreihig sticken, bis eine drei-, fünf-, sieben-, ja selbst neunnahtige Ausführung als Höchstmaß des Möglichen und wahrscheinlich auch Bezahlbaren entsteht.
Schutz und Prunk kann noch durch Wachseln der Stickmuster mit Hilfe des gekerbten „Riedlholzes“ sowie Einstreichen der Nähte mit Graphit oder Schmirgelstein und anschließendem Glänzen („Wichsen“) erhöht werden. Das derart „silbernahtige“ Prachtstück wird künftig getreu nach Börries von Münchhausen seine Bestimmung erfüllen: „Geschlechter kommen, Geschlechter vergehn, hirschlederne Reithosen bleiben bestehn!“
Über Lederhose, Hosenträger und Weste trägt man zur Salzburger Männertracht, wie etwa der Topograf Lorenz Hübner im Jahr 1796 für den Pinzgau betont, „um die Lenden eine breite lederne Bauchgurte, welche entweder bunt ausgenäht oder zierlich mit kleinen weißen Nägelchen beschlagen und vielfach nach innen einen ledernen Schlauch hat, um das Geld aufzubewahren“. Leider erzeugte man im Salzburger Land lange Zeit keine solchen Gürtel mehr, jetzt gibt es sie wieder.
Früher war Radstadt dafür weithin bekannt, sodass dieses wohl gehütete Familienstück vom Vater auf den Sohn vererbt wird. Da sich auch niemand der Reparatur ihrer kunstvoll hergestellten Verzierung in Federkielstickerei widmet, werden die Reste zerfallender Ranzen vom Taschner in neue Trachtentaschen für Damen einbezogen; dabei ist der Teil mit der Schließe aus Gelbguss ebenso attraktiv wie das aufknöpfbare „Blattl“, das sich im 19. Jahrhundert als Verdeckung der Verschnürung fischblasenförmig herausgebildet hat. Neu, aber nach barockem Vorbild der Einkaufs- und speziell Fleischtaschen aus einem mit Leder überzogenen Strohgerüst, wird der „Zöger“ als heute begehrte Damen-Tragtasche kunstvoll mit Leder überzogen.
Doch zurück zu meiner Betriebsgründung: Der Anfang des Betriebes war sehr schwierig, damals hatte die Tracht nicht den Stellenwert wie heute. Es war die Zeit, in der die Bauern – noch immer – städtische Kleidung bevorzugten, die alten Geräte und Werkzeuge nicht mehr schätzten und teils verschleuderten. Es folgte eine Strukturänderung in allen Bereichen. Maschinen traten an Stelle der Handarbeit und damit verbunden war eine Geringschätzung der alten, bodenständigen Tracht. In dieser Zeit konnten wir den Betrieb nur durch Aufträge von Vereinen (Musik, Schützen, Trachtlervereinen und dergleichen, wie z. B. dem Zauchenseer Trachtenverein) aufrechterhalten.
In den 1960er-Jahren hatte ich bereits Überlegungen angestellt, meinen Beruf aufzugeben, doch zuvor ließ ich mich 1962 noch bei einer Innsbrucker Bekleidungsfabrik, die Leder- und Lodenoberbekleidung fertigte, zur industriellen Bekleidungsherstellung ausbilden. Doch in diesem Dezenium bekam dann die Tracht wieder einen höheren Stellenwert und damit kam endlich eine Zeit, in der sich der Betrieb positiv entwickeln konnte. Neben dem Bedarf der einheimischen Bevölkerung kamen nun vermehrt auch Aufträge von den Gästen des zunehmenden Fremdenverkehrs. 1965 war die finanzielle Situation so gefestigt, dass ich heiraten konnte, 1972 wurde ein Grundstück angekauft und mit viel Eigenleistung begonnen, ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. 1977 konnten wir Einzug halten und mit dem 1986 aufgenommenen Handel mit einschlägigen Artikeln war endlich die lange Durststrecke beendet. Leider ist mit mir wahrscheinlich in Altenmarkt der Meisterbetrieb des Säcklers auch schon wieder zu Ende, da die beiden verheirateten Töchter andere Berufe ergriffen, ebenso ihre Ehemänner in anderen Berufen tätig sind. Gegenwärtig existiert der Betrieb noch.
Früher waren die Leinen- und Tuchweber in fast allen Orten unserer Gegend vertreten und übten ihren Beruf teils zu Hause in der eigenen Werkstatt oder auf der Stör aus. Einer, der diesen Beruf noch in seiner Jugend erlernte und auch ausgeübt hat, erzählt dazu:
Mein Ziehvater war Weber, einer von den fünf Altenmarkter Webern, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hier tätig waren. Zwei davon übten dieses Handwerk auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Der Reihe nach aufgezählt waren dies:
Der Brunnbauern Weber, Haus Nr. 72, der bis zur Jahrhundertwende arbeitete.
Der Grahweber, Haus Nr. 10, er übte dieses Handwerk bis 1910 aus.
Der Grundnerweber Josef Trattner, Haus Nr. 50, war bis zu seinem Tod 1942 tätig. Zwei Söhne, beide ausgebildete Weber, sind im Zweiten Weltkrieg gefallen.
Der Weber Ferner, Haus Nr. 39, arbeitete bis 1939 und anschließend führte der Ziehsohn Johann Kohlreiter bis ca. 1957 das Handwerk weiter und der letzte Altenmarkter Weber war
Matthias Weitgasser, der Schattauer, Haus Nr. 77. Er arbeitete bis 1960 am Webstuhl, wobei er aber ab 1955 nicht mehr das rupfene (gröbere, raue Leinenqualität z. B. für tägliche Leintücher, Tischwäsche, grobe Hemden der Männer und Dienstboten) und harbene (weichere, bessere Leinenqualität für Untergewand und feinere Hemden) Tuch erzeugte, sondern nur mehr Fleckerlteppiche (als Kette dienten alte und neue Stoffreste, die zu Streifen geschnitten wurden. Speziell im und nach dem Zweiten Weltkrieg eine beliebte Ersatzware) webte.
Die Altenmarkter Weber gingen auch auf die Stör. Auf Grund langjähriger Übung hatte jeder seinen eigenen Störbezirk, so ging z. B. der Schattauer in die Taurach, also von Radstadt bis Untertauern. Die meisten Bauern hatten einen eigenen Fachwebstuhl, dieser stand jedoch nur als Rohwebstuhl zur Verfügung und musste vom Weber erst eingerichtet werden.
Dazu hatte der Weber die notwendigen Sachen wie Zeug, Blattl, Schlagbaum oder Schlagkamm, Spagat, Stäbe, Rollen und dergleichen mitzubringen. Der Bauer stellte das aus dem gebrechelten Flachs gewonnene und gesponnene Garn zur Verfügung, wobei aus dem Werch (schlechtester Abfall beim Brecheln, kurze Flachsfasern, oft mit harten Teilen versetzt) das rupfene Tuch und aus dem Haar das harbene Tuch (mittlere Qualität) gemacht wurde (die feinste Qualität war der Reisten). Je nach Größe der Bauern war der Weber zwischen zehn Tagen und vier Wochen auf dem Hof zur Stör. Die Entlohnung erfolgte nach Schicht, seltener nach der Stückzahl des erzeugten Tuches. Hatte der Bauer keinen eigenen Webstuhl, brachte er das Rohmaterial zum Weber und dieser webte dann zu Hause das Tuch in Lohnweberei aus. Der Weber sprach über seine Arbeit nicht vom „Weben“, sondern vom „Wiachen“ (Wirken).
Nun eine kurze Beschreibung des Webvorganges: Zuerst war der Webstuhl aufzustellen und zu bespannen. Beim Bespannen mussten 16 bis 20 Spagatspulen mit je 60 bis 80 Meter Spagat auf dem Webstuhl aufgezogen werden. Das dauerte ca. einen Arbeitstag. Erst dann konnte mit dem Weben begonnen werden. Das Weben war eine sehr zeitraubende und anstrengende Arbeit. Jeder einzelne Faden musste zweimal überklaubt werden und dann war jeder Faden mit dem Schlag an den Beginn des zu webenden Stückes anzuschlagen. Für ein rupfenes oder harbenes Tuch von 110 cm Breite und drei Meter Länge brauchte man etwa einen Arbeitstag, für einen Fleckerlteppich des gleichen Ausmaßes ca. drei Stunden, vorausgesetzt, dass sich kein Fehler einschlich.
Weil beim Weben sehr häufig die Fäden gerissen sind und immer wieder zusammengeknüpft werden mussten, sprechen die Weber von drei Berufen, die besonders große Geduld erfordern: dem Schullehrer, dem Beichtvater und dem Weber.
Damit sich die Fäden nicht verhaspelten, mussten die Spagatschnüre dauernd mit der so genannten „Weberschlicht“ – das ist eine aus Wasser, Inslet (Rindertalg) und Roggenmehl hergestellte dünne Brühe – bestrichen werden. Der Anfang und das Ende des gewebten Stückes musste verknüpft werden, damit es sich nicht auflösen konnte. Dabei wurden sechs bis sieben Fäden zusammengenommen und einmal verknüpft.
Früher wurde bei den Bauern noch überall an sonnigen, frostgeschützten Stellen Flachs angebaut – eine sehr zeitaufwändige Arbeit. Der Flachs, der etwa 60 Zentimeter hoch wird, wurde nach der Ernte getrocknet und dann gedroschen. Dabei sammelte man auch die Samenkörner (Linset, Leinsaat, Leinsamen), denen man für die Gesundheit von Mensch und Tier große Bedeutung beimaß. Der nächste Weg führte in die Brechelstube oder zum Brechelloch, wo auf einem Rost über dem Feuer der Flachs durch ständiges Wenden ganz „resch“ geröstet wurde. Während in der Weiterverarbeitung die von den Männern bedienten großen Brecheln (Stampfzangen aus Holz) die Grobarbeit besorgten, machten die Frauen an den kleinen Brecheln die Feinarbeit. Anschließend wurde das Gebrechelte durch die Hechel (Holzbrett mit vielen ca. 15 Zentimeter langen spitzen Zacken) gezogen. Das dabei gewonnene Haar wurde zum „Haarreistel“ zusammengedreht und aufgehängt, das als Nebenprodukt anfallende Werch kam in Körbe. Beide lieferten durch Spinnen Fäden, die dann vom Weber weiterverarbeitet wurden.
Der Weber machte auch aus Schafwollgarn das „rassane“ Tuch, das grün gefärbt für Männerröcke verwendet wurde. Beim „Rass“ bestand die Kette aus Leinen und der Schuss aus Wolle. Außerdem kannte man noch das gewalkte (verfilzte) Tuch für gewalkte Röcke, dafür wurden die Reinwollstoffe gekocht und gewalkt und damit verfilzt. Wurden Muster oder Formen in das Tuch eingewebt, so sprach man vom „Zwillich“. (Zwillich oder älter Zwielich ist eigentlich ein strapazierfähiges Baumwoll- oder Leinengewebe aus gezwirntem festen Faden in spezieller Bindung[3007]).
Die Weberarbeit war auf den Winter beschränkt, weil die Bauern ja vorher den Flachs ernten, trocknen, dreschen und brecheln mussten und die Frauen das Garn zu spinnen hatten. Im Sommer und Herbst betreuten die Weber meistens eine kleine Landwirtschaft oder gingen tagwerken. Im Winter gab es dann aber so viel Arbeit, dass oftmals Kärntner Landweber aufgenommen wurden, um die anfallende Stör- und Heimarbeit bewältigen zu können. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der Anbau von Flachs immer mehr ab und hörte schließlich ganz auf. Damit verschwand auch das Weberhandwerk.
Ein Beruf, dessen Erzeugnisse und Berufsbild sich sehr gewandelt haben, ist der des „Klampferers“ (Klempner oder Spengler). In Hüttau war dies der „Baracker Sepp“. Er hauste in einem kleinen Häuschen zwischen Ort und Bahnhof, welches während des Bahnbaues aus Schwellen errichtet wurde. Schon sein Vater war Klampferer und Vater und Sohn zogen früher mit ihren „Kraxen“ (Rückentragen) im Fritztal von Bauer zu Bauer und von Haus zu Haus, um die kaputten Blechgefäße, bzw. -geschirre zu flicken. Mit Lötlampe und Lötkolben, Blechschere, kleinem Amboss und Hammer wurden die Pfannen und Reindl, Häferl und Eimer und dergleichen von ihnen geflickt und genietet. Außerdem machten sie auch noch Glaserarbeiten, deckten Blechdächer und reparierten Gebrauchsgegenstände aller Art.
Der Baracker Sepp war ein Original, sehr belesen, aber leider dem Alkohol zugetan. Nach dem Tode seiner Mutter hauste er allein und hilflos in seiner Baracke und so veranlasste die Gemeinde, ihn ins Altenheim zu überführen. Im Altenheim hat er sich wieder erholt und war dort wegen seiner Hilfsbereitschaft und handwerklichen Fähigkeiten für alle möglichen Arbeiten eingesetzt und ist dort auch hoch betagt gestorben.
Die Hauptfunktion des Klampferers auf dem Lande bestand seit dem 19. Jahrhundert in Reparaturen, dem „Kesselflicken“, also einem armseligen Erwerb. In vergangenen Jahrhunderten war der Klampferer mit der Herstellung von Hausrat aus Blech mit Dächern, Dachrinnen und ähnlichen Arbeiten befasst, die aus gehämmertem und gezogenem Blech durch Biegen, Bördeln und Löten[3008] herzustellen waren. In der modernen Spenglerei setzt sich dieses Gewerbe fort.
Für die Befeuerung der Schmiedeessen wurde noch vereinzelt bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts Holzkohle erzeugt. Die Holzkohle wurde von den Kohlbrennern (meist kleine Bauern oder ältere Waldarbeiter und dergleichen) nach der bewährten Art und Weise, so wie von den Vorfahren überliefert, hergestellt. Die Kohlstätten befanden sich auf halbwegs ebenen Plätzen in mehreren Teilen des Gemeindegebietes.
Aus der Erzählung eines alten Huf- und Zeugschmiedes, dessen Vater noch selbst nebenbei als Köhler tätig war, wird diese Tätigkeit wie folgt geschildert: Eine gewisse Menge Rundhölzer von 4 Meter Länge – meist schlechteres und kleineres Holz, keine Bloche – wurde zu einem rechteckigen Haufen von etwa 8 Meter Länge und einer Höhe von durchschnittlich 2 Meter aufgeschlichtet und mit einer Bretterverschalung umgeben. Der Raum zwischen Holzhaufen und Schalung wurde mit „Kohllösch“ (granulierte oder staubartige Überbleibsel des Kohlbrennens) und Erde ausgefüllt und überdeckt, sodass keine Luft dazu konnte. Nur an der Vorderseite des Haufens wurde eine Stelle freigelassen, wo dann mit Holzspänen der Haufen entzündet wurde. Nach erfolgtem Anbrennen wurde auch diese Stelle mit Kohllösch und Erde bis auf ein kleines Loch abgedeckt. Dadurch konnte das Holz nicht richtig brennen, sondern nur „glosen“ (glimmen) und verwandelte sich schön langsam in Holzkohle. So ein Haufen „gloste“ einige Wochen dahin und musste vom Kohlbrenner ständig beobachtet und kontrolliert werden. Beim Aufflackern eines Feuers musste er sofort mit Kohllösch, Erde und Wasser das Feuer eindämmen, denn sonst verbrannte das Holz zu Asche.
Die so gewonnene Holzkohle war ein begehrter Artikel für das Schmiedegewerbe, wurde aber auch für das Eisenwerk in Tenneck benötigt und dorthin in größeren Mengen geliefert. Als Nebenprodukt beim Kohlbrennen gab es das Kohlöl, das für Heilzwecke bei Mensch und Tier verwendet wurde. Soweit die Erzählung des alten Schmiedemeisters über diese Erwerbsmöglichkeit aus unserem Gebiet, die auch noch in Volksliedern wie „Bin da schwoaz Kohlbauernbua“ besungen wird.
[2975] Zum Landhandwerk siehe Beck, Rainer: Handwerkliche Produktion und dörfliche Gesellschaft im 18. Jahrhundert – ein bayerisches Beispiel. In: Reith, Reinhold (Hg): Praxis der Arbeit. Probleme und Perspektiven der handwerksgeschichtlichen Forschung. Frankfurt–New York 1998, S. 147–186. (= Studien zur historischen Sozialwissenschaft; Bd. 23).
[2976] Beck, Rainer: Handwerkliche Produktion und dörfliche Gesellschaft im 18. Jahrhundert – ein bayerisches Beispiel. In: Reith, Reinhold (Hg): Praxis der Arbeit. Probleme und Perspektiven der handwerksgeschichtlichen Forschung. Frankfurt–New York 1998, S. 147–186. (= Studien zur historischen Sozialwissenschaft; Bd. 23), S. 157–159.
[2977] Beck, Rainer: Handwerkliche Produktion und dörfliche Gesellschaft im 18. Jahrhundert – ein bayerisches Beispiel. In: Reith, Reinhold (Hg): Praxis der Arbeit. Probleme und Perspektiven der handwerksgeschichtlichen Forschung. Frankfurt–New York 1998, S. 147–186. (= Studien zur historischen Sozialwissenschaft; Bd. 23), S. 163.
[2978] Die österreich-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Oberösterreich und Salzburg. Wien, 1889, S. 78f. Zitiert nach: Zwink, Eberhard (Hg): Salzburger Quellenbuch. Von der Monarchie bis zum Anschluß. Salzburg 1985, 23f (= Schriftenreihe des Landespressebüros, Serie Salzburg Dokumentationen, Nr. 86).
[2979] Chronik der Gemeinde Kleinarl. Zusammengestellt und verfasst von Gottfried Steinbacher. Kleinarl 1992, S. 335.
[2980] Chronik von Saalfelden. Hrsg. v. der Marktgemeinde Saalfelden. 2 Bde. Innsbruck 1992. Bd. II, S. 494.
[2981] Chronik von Saalfelden. Hrsg. v. der Marktgemeinde Saalfelden. 2 Bde. Innsbruck 1992. Bd. I, S. 312–321.
[2982] Salzburger Landesinstitut für Volkskunde (SLIVK), Archiv Österreichischer Volkskundeatlas, Fragebogen 1.1., Saalfelden S. 74. Der Fragebogen wurde vom 1914 geborenen Volksschuldirektor J. L. ausgefüllt.
[2983] Handwerk in Schleswig-Holstein 1900 bis heute. Hrsg. v. der Gesellschaft für Volkskunde in Schleswig-Holstein e.V., Großbarkau 1997, S. 6f.
[2984] Chronik von Saalfelden. Hrsg. v. der Marktgemeinde Saalfelden. 2 Bde. Innsbruck 1992. Bd. II, S. 504.
[2985] Chronik von Saalfelden. Hrsg. v. der Marktgemeinde Saalfelden. 2 Bde. Innsbruck 1992. Bd. II, S. 504.
[2986] Wysocki, Josef: Grundzüge der wirtschaftlichen Entwicklung. In: Zwink, Eberhard (Hg): Die Ära Lechner. Das Land Salzburg in den sechziger und siebziger Jahren. Salzburg 1988, S. 49–62, hier S. 50.
[2987] Dirninger, Christian: Konjunkturelle Dynamik und struktureller Wandel in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Salzburg im 20. Jahrhundert. In: Dopsch, Heinz; Hans Spatzenegger (Hg): Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bd. II/4, S. 2746ff. Exemplarisch dargestellt für die im „erweiterten Zentralraum“ liegenden Gemeinden Seekirchen und Puch siehe ders.: Die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Dopsch, Elisabeth; Heinz Dopsch (Hg): 1300 Jahre Seekirchen. Geschichte und Kultur einer Salzburger Marktgemeinde. Seekirchen am Wallersee 1998, S. 638–655. – ders.: Die industriell-gewerbliche Wirtschaft im 20. Jahrhundert. In: Ammerer, Gerhard: Puch bei Hallein. Geschichte und Gegenwart einer Salzburger Gemeinde. Puch bei Hallein 1998, S. 463–484.
[2988] Wysocki, Josef: Die Wirtschaft Salzburgs im 19. Jahrhundert. In: Dopsch, Heinz; Hans Spatzenegger (Hg): Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bd. II/4, S. 2713–2742. – Für das 20. Jahrhundert: Dirninger, Christian: Konjunkturelle Dynamik und struktureller Wandel in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Salzburg im 20. Jahrhundert. In: Dopsch, Heinz; Hans Spatzenegger (Hg): Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bd. II/4, S. 2796f.
[2989] Neumayr, Ursula J.: Unter schneebedeckten Bergen. Entwicklungen der Landwirtschaft im Pinzgau im langen 20. Jahrhundert, ca. 1890–1990. Diss. Salzburg 2001, S. 9.
[2990] Chronik der Gemeinde Kleinarl. Zusammengestellt und verfasst von Gottfried Steinbacher. Kleinarl 1992, S. 228.
[2991] Dirninger, Christian: Konjunkturelle Dynamik und struktureller Wandel in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Salzburg im 20. Jahrhundert. In: Dopsch, Heinz; Hans Spatzenegger (Hg): Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bd. II/4, S. 2801.
[2992] Bätzing, Werner: Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft. 2. Auflage. München 2003, S. 117.
[2993] Bätzing, Werner: Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft. 2. Auflage. München 2003, S. 119–122.
[2994] Dirninger, Christian: Konjunkturelle Dynamik und struktureller Wandel in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Salzburg im 20. Jahrhundert. In: Dopsch, Heinz; Hans Spatzenegger (Hg): Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bd. II/4, S. 2743–2812.
[2995] Dirninger, Christian: Konjunkturelle Dynamik und struktureller Wandel in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Salzburg im 20. Jahrhundert. In: Dopsch, Heinz; Hans Spatzenegger (Hg): Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bd. II/4, S. 2750f.
[2996] Siehe http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.m/m017834.htm: Madersperger ließ sein 1815 erhaltenes Privileg und Patent der Nähmaschinenerzeugung leider bis 1818 verfallen. 1846 kam E. Howen in Amerika mit einer Nähmaschine auf den Markt; 1851 erfand er den Reißverschluss. Schon 1790 hatte Thomas Saint in England eine Kettenstichmaschine erfunden und 1829 der Franzose Barthélmy Thimmonier, doch diese Maschinen fanden auch in der Industrie kaum Verwendung. Für Haushalte und kleinere Betriebe in Europa wurde die Nähmaschine von Isaac Merret Singer bedeutsam, die ab 1850 den Markt beherrschte. Bereits ab 1900 gehörte die Singer-Nähmaschine in Österreich zum üblichen Heiratsgut mittelbürgerlicher Töchter.
[2997] Das elektrische Bügeleisen wurde 1888 von Friedrich Schindler in Bregenz entwickelt, 1890 patentiert und ab 1897 von seiner Firma AEG angeboten.
[2998] Im Vergleich: So erinnerte sich der 1933 in Wien geborene Wolfgang Aggermann-Bellenberg, dass seine Familie zwischen 1933 und 1938 in die Sommerfrische am Wolfgangsee statt des in Wien verwendeten elektrischen Bügeleisens die beiden alten Staheleisen mitnahm, damit auch am Badstrand, in der Sonne, gebügelt werden konnte. Ein ungewohnter und besonderer Spaß für ihn und seine Brüder, denn die Kinder hatten die Aufgabe, ein Holzfeuer für die Stahel zu unterhalten.
[2999] Schmeller, Johann Andreas: Bayerisches Wörterbuch. Nachdruck der 2. Ausgabe München 1872–1877. München 1985, Bd. I/2, Sp. 908f: von lat. Culcitra, culctra; im Gebirge und bei Holzknechten übliche, abgesteppte Decke.
[3000] Vgl. dazu Adrian, Karl: Volksspiele. Mit einem Kommentar von Ulrike Kammerhofer-Aggermann. In: Vom Frühling bis zum Herbst (= Bräuche im Salzburger Land. Zeitgeist – Lebenskonzepte – Rituale – Trends – Alternativen. CD-ROM 2) Hrsg. v. Lucia Luidold und Ulrike Kammerhofer-Aggermann, Redaktion: Melanie Lanterdinger. (= Salzburger Beiträge zur Volkskunde 14) Salzburg 2003.
[3001] Seit dem Mittelalter ist Sebastian u. a. der Patron der Gerber und vieler Eisengewerbe und wird offenbar über die eisernen Nadeln – analog zu seinem Marterinstrument den Pfeilen – Patron der Schuster und Schneider.
[3002] Reith, Reinhold: Das Lexikon des alten Handwerks. Vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. München 1990, S. 84f.
[3003] Schmeller, Johann Andreas: Bayerisches Wörterbuch. Nachdruck der 2. Ausgabe München 1872–1877. München 1985, Bd. 2/1, Sp. 779ff.
[3004] Schmeller, Johann Andreas: Bayerisches Wörterbuch. Nachdruck der 2. Ausgabe München 1872–1877. München 1985, Bd. 2/1, S.p. 222. – Den Niedergang der Säckler nach dem Ersten Weltkrieg hat Alma Scope dargestellt in: Kammerhofer-Aggermann, Ulrike; Alma Scope; Walburga Haas (Hg.): Trachten nicht für jedermann? Heimatideologie und Festspieltourismus dargestellt am Kleidungsverhalten in Salzburg zwischen 1920 und 1938. (= Salzburger Beiträge zur Volkskunde, Bd. 6). Salzburg 1993.
[3005] D. h. mit einer Abfindung entlassen.
[3006] Schmeller, Johann Andreas: Bayerisches Wörterbuch. Nachdruck der 2. Ausgabe München 1872–1877. München 1985, Bd. II/1, Sp. 420: hin- und her schieben.
[3007] Z. B. Schmeller, Johann Andreas: Bayerisches Wörterbuch. Nachdruck der 2. Ausgabe München 1872–1877. München 1985, Bd. 2/2, Sp. 1170.
[3008] Reith, Reinhold: Das Lexikon des alten Handwerks. Vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. München 1990, S. 124–127.