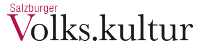

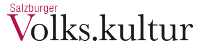

Inhaltsverzeichnis
Die folgende Begriffssammlung soll kein wissenschaftliches Lexikon sein, sondern eine Gesprächshilfe für Wissenschaftler/innen und Laien. Sie hat sich aus der Arbeit an der Reihe „Bräuche im Salzburger Land“. Zeitgeist – Lebenskonzepte – Rituale – Trends – Alternativen ergeben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder ein wissenschaftliches Auswahlsystem. Sie listet jene Bezeichnungen auf, die sich im Diskurs der Wissenschaftler/innen und Laien rund um dieses Projekt als erklärungsbedürftig erwiesen haben. Ebenso führt die Zusammenstellung Schlagworte auf, die derzeit in populären Debatten in den Medien vielfach verwendet werden, die aber entweder überhaupt schwammig und undefiniert oder in anderer Weise definiert in der Bevölkerung gebraucht werden, als sie in wissenschaftlichen Arbeiten Verwendung finden. Weiters nimmt die folgende Zusammenstellung jene Fachbezeichnungen auf, die zu den Kernfragen der Beschäftigung mit den Teilbereichen der Volkskunde gehören, für die sich Laien unter dem Terminus „Heimat- und Brauchtumspflege“ interessieren. Da diese Begriffe im 20. Jahrhundert vielfach neu definiert worden sind, sollten sie Laien, die sich mit jenen Bereichen der Volkskultur intensiv beschäftigen, nicht fremd sein.
Bis ins frühe 19. Jahrhundert gaben ständische Richtlinien vor, wie einzelne Stände ihr Leben zu gestalten hätten, welche Bildungswege und Positionen ihnen offen stünden. Vielfach gingen diese Vorgaben bis ins kleinste Detail der Lebensgestaltung und wurden auch durch die soziale Kontrolle verstärkt, kontrolliert und sanktioniert. Seit dem 20. Jahrhundert leben wir in einer offenen, mobilen, multikulturellen, europäischen, globalen Gesellschaft. All diese Bezeichnungen zeigen bereits Schwerpunktsetzungen einzelner Zeiten und Gesellschaftsgruppen auf. Daher bleibt jedem Einzelnen die Schwerpunktsetzung seiner Lebensanschauung, Interessen und Lebensentwürfe überlassen. Diese Freiheit ist Chance und Verunsicherung zugleich, sie ruft auch stets wieder neue kompensatorische Modelle hervor. Aus Traditionen, Strömungen, Moden und Trends entstehen immer wieder neue Alternativen auf der Suche nach der besten aller Lebensformen sowie nach dem Sinn des Lebens.
Authentizität, dt. „Echtheit“, ist ein Begriff der Relation und Reflexion. Er enthält bereits Sehnsüchte, Erfahrungen und Bewertungen der Verwender (C. Dahlhaus). Echtheit, Authentizität, lässt sich (außer bei Metallen, Edelsteinen etc.) nur aus dem Kontext und über die beteiligten Menschen feststellen. Als „echt“, „uralt“ oder „authentisch“ deklarierte Ereignisse oder Dinge zeigen soziale Bewertungen auf. Sie rufen daher stets Befürworter sowie Gegner hervor, denn ihre „Echtheit“ ist nicht absolut definierbar, sie entspringt der Sozialisation und dem Handlungsrahmen der Akteure. Das heißt, jede Kulturerscheinung hat jeweils jene „Echtheit“, die ihr eine Menschengruppe in einem ganz bestimmten zeitlichen und sozialen Kontext zugesteht (W. Benjamin). Häufig werden die Begriffe „authentisch“ und „echt“ als Qualitätszeichen im Gegensatz zu „schlecht“ oder „künstlich“ verwendet (H. M. Wolf).
Heute sehen sich die Blasmusikverbände gerne als Nachfolger der erzbischöflichen Hof- und Gardemusik, der Stadtpfeifer sowie der Bürgermusiken und stellen so ihre Vorstellungen von historischer Anbindung dar. Die enge Beziehung zur österreichischen Militärmusik ist offensichtlich und zeigt sich in den Nachfahren der 1868 geschaffenen Lyra-Abzeichen und einzelnen Instrumenten. Im 19. Jahrhundert kam es durch die neu bzw. fortentwickelten Blechblasinstrumente zur Gründung von Militärmusikkapellen, die schließlich zu Elementen der städtischen Festgestaltung wurden. Am Vorbild der 1851 reformierten österreichischen Militärmusik (Neuordnungen weiters 1900 und 1945) entwickelten sich seit dem Staatsgrundgesetz von 1867 auch bürgerliche Zusammenschlüsse. Anfangs waren diese Verbände oft uneinheitlich gekleidet, ab 1900 erhielten sie vermehrt uniformähnliche Gewänder, ab den 1960er-Jahren begann die Einkleidung in stilisierte regionale Trachten.
Bräuche stellen aus Sitten und Normen erwachsene, gemeinschaftsbezogene sowie gemeinschaftsbildende, ritualisierte Handlungen von großer Signalwirkung dar, die einem jeweiligen Handlungsrahmen (siehe Weltbild, siehe Kultur) entspringen. Daher waren für die Vorläufer und Anfänge der wissenschaftlichen Volkskunde „Sitte und Brauch“ ein untrennbares Paar, nämlich die aus einer Kultur erwachsenen Sitten als moralisch-ethische Grundsätze auf Grundlage der Normen und den daraus abgeleiteten ritualisierten Handlungen. Bräuche sind Verhaltensformen oder Verhaltensmuster, die dem Konsens einer Gruppe entspringen und die Konformität der Gruppe garantieren. Als fixer Bestandteil eines Festkreises (Handlungsanleitung) oder einer Jahreszeit stellen sie auch Zäsuren im Jahr- und Lebenslauf dar, sie machen Zeit erlebbar und messbar. Heute wird die Begründung solcher Traditionen häufig in der Geschichte gesucht (K. Köstlin). Viele Bräuche wurden und werden von Herrschenden zur Durchsetzung ihrer Interessen erfunden (E. Hobsbawm). Antibräuche richten sich gegen solche Bräuche und zeigen unterschiedliche Auffassungen in der Gesellschaft an (H. M. Wolf). Bräuche, Normen und Rituale entsprechen dem Bedürfnis der Menschen nach lokaler und sozialer Gemeinschaftsbildung und Absicherung (bis zur Ausgrenzung), Selbstdarstellung, Identifikation. Bräuche haben daher eine wichtige soziale und psychologische Bedeutung. Bräuche geben Formen der Kommunikation bzw. Distinktion (P. Bourdieu) vor. Sie enthalten häufig Aspekte der Rechtsgeschichte, Rechtssprechung, der Wirtschaft und Religion. Erneuerungsbewegungen im 20. Jahrhundert haben vielfach vergessen lassen, dass neben organisierten öffentlichen Schaubräuchen eine Fülle von Sitten und Bräuchen im Alltag existierte und existiert, die den Ausübenden selbstverständlich und unverzichtbar erscheinen und damit Ausdruck ihrer Kultur sind. Öffentliche Bräuche haben vielfach durch kulturpolitische und vereinsmäßige Pflege eine Stilisierung und Fixierung im Jahrlauf (siehe Jahr(es)lauf) erfahren. Touristische Initiativen schließen sich oft an bestehende Bräuche an oder richten neue nach dem Bedürfnis der Gegenwart ein. Bräuche unterliegen einem steten Wandel, sie sind ein „work in progress“. Daher ist es gerade in einer modernen, vielschichtigen Gesellschaft wichtig, dass unterschiedliche Gesellschaftsgruppen ihre eigenen Bräuche lebendig erhalten und leben dürfen. Das Miteinander unterschiedlicher Kulturen wird so zur Bereicherung der gesamten Gesellschaft.
„Volkskultur aus zweiter Hand“ (H. Moser). „Der sentimentalische Zustand des Brauches“ (U. Jeggle). „Brauchtumspflege“ wurde in den 1930er-Jahren zum Begriff für den in der Heimatschutzbewegung entwickelten Gedanken, neben der Denkmalpflege auch nichtmaterielle kulturelle Erscheinungen – „Sitten und Gebräuche“ – aus ihrem natürlichen Wandel herauszuheben, zu erhalten und zu pflegen. Der Begriff entwickelte sich im Umkreis der Erhaltungs- und Brauchtumsvereine zu einem Schlagwort, mit dem sich der Erhalt einer für besser erachteten regionalen (im Nationalsozialismus dann rassischen), weitgehend ländlichen Kultur verband. „Brauchtum“ wurde zur biologistischen, unabänderlichen Ausdrucksform von Rasse und Mythos. Ab 1922 war mit der Brauchtumspflege der Vereine vielfach auch ein Rassen- und Klassenkampf im Sinne des Nationalsozialismus verbunden. Im Nationalsozialismus wurde Brauchtumspflege in Verbindung mit „Volkstumspflege“ zum Mittel der Indoktrination. Aus der Verknüpfung der beiden Begriffe entwickelte sich auch der Begriff „Heimatpflege“, der einen kulturpessimistischen Rettungsgedanken in Verbindung mit einem Bestreben nach „Reinhaltung der Art“ implizierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde „Heimat- und Brauchtumspflege“ zum Inhalt der Pflegeorganisationen, der Vereine und Länder. Sie diente der Wiedererrichtung eines Österreichbewusstseins. In den 1980er-Jahren wurde der Begriff aufgrund seiner zeitgeschichtlichen Belastungen durch die NS-Zeit weitgehend tabuisiert. Infolge der universitären Erkenntnisse wurde der Begriff durch neu Geschaffenes ersetzt. „Volkskultur“ – mit den Zusätzen „lebendig“, „regional“, „authentisch“, „eigenständig“ – wurde als neuer Begriff zum Schlagwort, das eine weiterführende Gestaltung einer auf Traditionen beruhenden regionalen Kultur vorgeben wollte. Mit dem neuen Begriff geschah vielfach auch eine inhaltliche Öffnung zur Veränderung und Einbeziehung gegenwärtiger Bedürfnisse sowie ein kritischerer Umgang mit den NS-Begriffen und -Wertungen.
Brauchtumsvereine entstanden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts am Beispiel großbürgerlicher Gesellschafts- und Kulturvereine, die sich im Zuge des Historismus auch der als exotisch bewerteten „Nationalkultur“ stadtferner Regionen spielerisch annahmen. Sie griffen Ideen der Nationalökonomie und des Heimatschutzes auf und frönten der Laienethnografie. Für Salzburg ist die mäßig deutschnationale Sektion Salzburg des „Alpenvereines“ (Gründung 1870) und der 1882 gegründete, gemäßigt liberale „Touristen Club“ mit seinen Kostümbällen und Festzügen zu nennen (H. Haas). 1881 entstand der mittelbürgerliche „Geselligkeitsclub Edelweiß“, der als erster eine Vereinstracht hatte. Die 1891 gegründete, großbürgerliche „Alpinia“ arbeitete eng mit der Landeskommission (Karl Adrian, gegründet 1911) zusammen und trug zur Rekonstruktion von Salzburger Tracht und Brauch erheblich bei. Ihre Trachtenfestzüge und Bauernhochzeiten führten zur Ausbildung des exklusiven Salzburger Flairs der ersten Festspieljahre (C. Zuckmayer: Henndorfer Elegie, Der Seelenbräu). Prägende Persönlichkeiten waren Gerbermeister August Neubauer, Schulrat Karl Adrian, Kammersänger Richard Mayr, Kostümbildner Carl Mayr u. v. a. Daneben entstanden am bayerischen Vorbild zwischen 1880 und 1913 viele kleinbürgerliche Trachtenerhaltungsvereine mit geselligen und gesellschaftspolitischen Interessen. Sie ermöglichten vielen Abwanderern vom Lande soziale Einbindung und standesähnliches Selbstbewusstsein. Die Heimatschutzbewegung wie der Ständestaat erhofften von solchen Vereinsbildungen die Rekonstruktion eines ständischen Bewusstseins. 1908 schlossen sich diese Vereine zum „1. Österreichischen Reichsverband der Volks- und Gebirgs-Trachten-Erhaltungsvereine“ mit Sitz in Salzburg (1939 Auflösung; 1939–1945 NS-Gauverband, ab 1948 Landestrachtenverband) zusammen, der ab 1912 eine gleichnamige Monatsschrift herausgab und für Österreich meinungsbildend wurde. 1926 gründeten 25 Mitgliedsvereine den „Salzburger Landes-Trachtenverband“. Bereits in den 1920er-Jahren wurde „die Trachtensache“ zum Fanal eines biologistisch-politischen Kulturkampfes, der im Ausschluss der sozialistischen „Arbeitertrachtler“ und der Forderung nach einem Verbot des Trachtentragens für Juden (1938 in der Gebirgs-Trachten-Zeitung veröffentlicht) gipfelte. Der 1939 errichtete „Gauverband der Heimat- und Trachtenvereine im Reichsgau Salzburg“ wurde im Sinne des Nationalsozialismus instrumentalisiert. Ab 1948 nahmen sich die Vereine im „Landestrachtenverband Salzburg“ der Erhaltung und Pflege von Brauchtum, Tracht und Volksmusik an und fungierten als Träger lokaler kultureller Bestrebungen (ab 1968 „Landesverband der Salzburger Heimatvereinigungen“). 1945 erfolgten die Gründung des Landesverbandes der Blasmusikkapellen und der Zusammenschluss der historischen Schützenkompanien.
Zahlen aus 2004/2005
Die Brauchtumsvereine umfassen 2004/2005 334 Heimatvereinigungen mit 17.203 Mitgliedern, 105 Schützenkompanien mit 9.889 Mitgliedern, 150 Musikkapellen mit 6.730 Mitgliedern, 398 Chöre mit 10.724 Mitgliedern und 395 Volkslied- und Volksmusikgruppen mit 1.580 Mitgliedern. Im April 2005 wurden im neu erschienenen Salzburger Museumsführer „Museen im Land Salzburg“ 114 Museen und Sammlungen erfasst. Auf der Museumshomepage des Landes Salzburg sind bereits 118 museale Einrichtungen erfasst. Sie werden privat, durch Gemeinden oder durch Vereine, Stifte und ähnliche Institutionen getragen. Von 797 Kulturvereinigungen in Salzburg (1998) sind 347 Kultur- und Religionsvereine nicht im Landesverband der Heimatvereinigungen erfasst. Eine repräsentative Umfrage des Landesverbandes Salzburger Volkskultur im August 2004 (durchgeführt von der Wissenschaftsagentur Salzburg) hat ergeben, dass von den volkskulturell Aktiven in Stadt und Land Salzburg lediglich 56,4 % in volkskulturellen Vereinen aktiv sind. Auch jene 43,6 %, die nicht in volkskulturellen Vereinen aktiv sind, haben die Fortführung von Traditionen, die Ausgestaltung von Festen, die Ausbildung von Identität zum Ziel. In den letzten Jahren entstanden Vereine (speziell Perchtenpassen), die Bedürfnisse der touristischen und Freizeitgesellschaft nach konsumierbarer „Authentizität“ und „Mythen“ bedienen. Seit den 1970er-Jahren existieren über 60 Kulturinitiativen im Lande. Ihr Ziel ist die Auseinandersetzung mit gegenwartsbezogenen Veränderungen der Lebensbedürfnisse, Ausdrucksformen und Bräuche sowie die Förderung moderner Künste und Künstler/innen.
Distinktion: siehe Repräsentation
Echtheit: siehe Authentizität
Die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein ist ein freiwilliger und partnerschaftlicher Zusammenschluss, der gemeinsame Möglichkeiten zum Nutzen seiner Mitglieder wahrnimmt. Erste Überlegungen zur Gründung begannen 1993, der EuRegio-Vertrag wurde am 22. Mai 1995 unterzeichnet. Das Leitbild der EuRegio wurde vom EuRegio-Rat am 20. November 1997 unterzeichnet, es enthält die Leitvorstellungen: Umsetzung des Europagedankens auf regionaler Ebene, Entwicklung der EuRegio als Arbeits- und Lebensraum für ihre Bewohner, Ausbau der EuRegio im Wettbewerb der Wirtschaftsräume sowie Entwicklung der Umwelt- und Lebensqualität in der EuRegio.
Zumindest seit der Antike fand in Europa ein steter Kulturaustausch statt, der ganz wesentlich zur Ausbildung dessen beitrug, was heute als „europäische Kultur“ bezeichnet wird. Diese Kulturwanderungen ergaben ein dichtes Netzwerk von Erscheinungen, von Bildungs- und Kulturwerten, das wissenschaftliche sowie technische Entwicklungen ermöglichte. Der Kulturaustausch brachte Übertragungen (Akkulturation, Inkulturation) von einem Volk/Land zum anderen mit sich, er führte zu eigenständigen Veränderungen (Reproduktionen) in Auseinandersetzung mit dem Neuen sowie zu teilweiser oder vollständiger Übernahme (Rezeption) kultureller Erscheinungen. Auch eigenständige Neuentwicklungen (Innovationen) sind darin feststellbar. Diese Prozesse gingen häufig mit Um- oder Neubewertungen Hand in Hand (siehe Kultur). Diese Kulturprozesse zeigen einerseits die zeitlichen und geografischen „Mainstreams“ der Geschichte auf, sie legen Zeitströmungen und Zeitgeist dar. Andererseits werden aus ihnen auch wirtschaftliche und politische Kontakte zwischen den Ländern sichtbar sowie die wechselnden Bewertungen von Ländern und Bevölkerungsgruppen. So war etwa bis zum 16. Jahrhundert Spanien für viele Lebensbereiche (Küche, Kleidung, Bräuche) vorbildlich oder im 18. Jahrhundert Frankreich, während im 20. Jahrhundert vielfach von einer „Amerikanisierung“ gesprochen wurde. Im Rahmen der Europäischen Union wird heute auf solche historische, weitreichende Kulturwanderungen durch Partnerschaften zwischen Regionen und Städten wieder Bezug genommen. Engräumige Kulturwanderungen und Kulturgemeinsamkeiten sind vielfach Ausgangspunkt moderner Aktivitäten der EuRegios.
Der Begriff „Gruppe“ wird in der Alltagssprache sowie in verschiedenen Wissenschaften höchst unterschiedlich und uneinheitlich definiert. Oft wird er gleichbedeutend mit Menge, Masse oder Bevölkerungsteil verwendet. Am häufigsten versteht man darunter heute eine Anzahl von Menschen, unter denen ein bestimmter sozialer Zusammenhalt besteht. Auch über andere Kriterien lassen sich Gruppen definieren: über die Größe, als Einheit, in der direkte, persönliche Beziehungen noch möglich sind; über äußere Grenzen, als klar abgegrenzte und erkennbare Einheit; über ein gemeinsames Handeln; über ein Wir-Gefühl; über gemeinsame Ziele; über eine interne Rollenstruktur und Hierarchie; über das langfristige Überdauern des Zusammenschlusses (G. Hartfiel und K.-H. Hillmann).
Handlungsanleitung, Handlungsrahmen: siehe Kultur
Der Begriff der „Heimat“ als einer lokalen oder regionalen Stätte der Herkunft und lebenslangen Bindung bzw. Sehnsucht entstand im späten 18. Jahrhundert mit der allgemeinen größeren Mobilität (G. Haid). Er bekam zwischen dem 19. Jahrhundert und der NS-Zeit vielfach biologistische Zusätze und wurde regional verankert und religionsähnlich überhöht. In den 1980er-Jahren begann eine kritische Debatte des Begriffsverständnisses „Wieviel Heimat braucht der Mensch?“ (J. Améry), „Heimat ist Tiefe, nicht Enge“ (H. Koren). Heute wird unter Heimat die Gesamtheit der durch Traditionen und spezifische Lebensbedingungen geprägten Erfahrungen der Kindheit und Jugend verstanden, im engeren Sinne die Region, in der der Mensch zur Persönlichkeit heranwächst bzw. seine entscheidenden sozialen Bindungen knüpft. In einer globalisierten Welt werden immer häufiger persönliche soziale Bindungen, Werte und Gefühle zur eigentlichen Heimat im Sinne eines Zentrums der sozialen Stabilisierung und Konsolidierung – ebenso wie äußere Scheinwelten zur virtuellen Heimat werden können.
„Heimatbewusstsein“ wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum politischen Schlagwort. Im Zuge der europäischen Öffnungen und Zusammenschlüsse entstand daraus das „Regionalbewusstsein“. Heimatbewusstsein ist ein lokal konstituiertes, erlerntes und sozialisiertes Verständnis regionaler, persönlicher und gruppenspezifischer Identität, das einen bestimmten Handlungs- und Bewertungsrahmen – oft harmonisch und integrativ und damit auch verzerrend angelegt – vorgibt.
Heimatpflege: siehe Brauchtum, Brauchtumspflege
Heimatschutz: siehe Bräuche, siehe Brauchtum, Brauchtumspflege
Identität ist für die Psychologie die Einheitlichkeit in der Betrachtung seiner selbst oder anderer aufgrund konstanter Einstellungen und Verhaltensziele. Die Ausbildung von Ich-Identität im Verlauf der Sozialisation ist zur Entwicklung der Persönlichkeit notwendig. Im Weiteren werden Werte und Rollen der sozialen Umgebung übernommen. Der Identitätsbegriff prägt seit den 1980er-Jahren auch die Arbeit der Kulturwissenschaften. Die Bedeutung der Identität sowohl für Individuen als auch für Gruppen wurde ersichtlich und als deren Ursachen wurden u. a. auch Formen der sozialen und regionalen Anbindung bzw. Abgrenzung erkannt. Identität braucht codierte und stereotypisierte Formen; sie macht sich an Ritualen, Bräuchen und Symbolen fest, die in steter Wiederkehr Sicherheit vermitteln, (Wieder-)Erkennungs- und Kommunikationswert haben. Sie dient der Repräsentation (Selbstdarstellung) und Distinktion (unterscheidenden Abgrenzung). Umgekehrt sind Identifikatoren auch Indikatoren, sie lassen Rückschlüsse auf das soziale Umfeld und die Sozialisation bzw. auf Ziele und Werte von Gruppen, Regionen etc. zu. Heute werden Menschen häufig unterschiedliche Rollenmuster und Verhaltensformen abgefordert (als Privatmensch, als Mitarbeiter, als Vereinsmitglied etc.), es kommt dadurch zur Ausbildung multiplexer Identitäten, wenn alle Rollenbilder tatsächlich positiv angenommene Teile einer Persönlichkeit darstellen. Ein stabiles Rollenbild erleichtert ebenso wie eine nachhaltig aufgebaute Identität Individuen und Gruppen die Entwicklung persönlicher Lebenskonzepte.
Jahr(es)lauf: siehe Bräuche
Kultur wird – ebenso wie Kult (siehe Ritual) – von lat. „colere“ = pflegen, bearbeiten, verfeinern abgeleitet. Während Kult oder Kultus die religionsgeschichtlich festgesetzte und geordnete Form des menschlichen Umgangs mit dem Heiligen und Göttlichen (meist in Form von Handlungen, Opfern und Symbolen an heiligen Orten zu heiligen Zeiten) ist, verstehen wir unter Kultur die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leitvorstellungen und Leistungen sowie Lebensbedingungen einer Bevölkerung in einem regional, historisch und zeitlich abgrenzbaren Raum als Ausdruck menschlicher Entwicklung. Für die Kulturwissenschaften ist Kultur ein historisch konstituierter und konkret sozialisierter Bezugs- und Reflexionsrahmen, durch den Menschen ihre Umwelt wahrnehmen, gestalten und bewerten (H. Gerndt). Kultur ist eine der Strategien, mit denen sich Menschen ihre Bezugssysteme aufbauen, mit ihnen leben und kommunizieren. Kulturen werden an ihren Indikatoren und Identifikatoren (siehe Identität) erkennbar (N.-A. Bringéus). In diesem erweiterten, sozial determinierten Kulturbegriff ist jeder Ausdruck menschlichen Kulturschaffens – unabhängig von technischer und geistiger Leistung – gleich beachtenswert als Ausdruck von Lebenswelten und Weltbildern (A. Hauser). Kultur ist die kreative Determination des Menschen (I.-M. Greverus). Kulturräume stellen kulturell (und meist auch politisch und/oder territorial) relativ geschlossene und relativ einheitliche Gebiete dar, in denen eine verbindende Kultur vorherrscht (siehe Europäische Kulturwanderungen, siehe EuRegio). Je geschlossener ein solcher Kulturraum ist, desto stärker sind in ihm die Lebensvorgaben (Systeme von Werten und Symbolen) für einzelne Individuen und Gruppen. Die Entwicklung anderer, eigenständiger Lebenskonzepte kann dadurch erschwert werden. Moderne Kulturwissenschaften setzen die geschichtliche Bedingtheit, Relativität und Wandelbarkeit von Kultur voraus und begegnen daher verschiedenen Ethnozentrismen. Das Verlassen der Selbstverständlichkeit und Verbindlichkeit, vor allem der eigenen Kultur, ermöglicht Toleranz, Akkulturation (Übertragung) und friedliches Zusammenleben. Kultur wird daher heute als Handlungsrahmen (mit seinen Unterteilungen Handlungsanleitung – Normen – Bräuche – Rituale, H.-G. Soeffner) verstanden. Sie ist ein Struktursystem kulturellen Denkens und Handelns, das vom jeweiligen Weltbild mit seinen Hintergründen ein strukturiertes Gefüge aus unterschiedlichen Normen, Handlungsanleitungen, Ritualen und Bräuchen erzeugt, das in sich geschlossen ist und auch nur aus sich heraus ersichtlich und erklärbar wird. Zu Akkulturation, Inkulturation (Übernahme als Teil der eigenen Kultur; der Reproduktion nahestehend, z. B. Lehnwort), Innovation: siehe Europäische Kulturwanderungen. Kulturphilosophische Theorien des Kulturpessimismus folgten vielfach auf die Aufgabe von Ethnozentrismen und sahen im kulturellen Wandel ausschließlich Prozesse des Verfalls und der Kulturzerstörung.
Über vergangene Lebensweisen geben uns Quellen Auskunft. An Quellen ist eine Fülle an Schriften und Objekten zu nennen: Es gibt Quellen in situ, die über landschaftliche Veränderungen, über Städtebau und Architektur etc. berichten und die wir noch an Ort und Stelle antreffen; Quellen aus dem Bereich der Künste stellen Zeugnisse der Verarbeitung von Zeitströmungen durch Künstler dar; Sachquellen aller Art geben über Materialkunde, Technik, Verwendungszwecke und deren Hintergründe Auskunft bzw. bereits über Strömungen der Wiederentdeckung und Neubewertung; unter den Schriftquellen spannt sich ein weiter Bogen von den Urkunden über Briefe, mediale Schriftquellen bis zu literarischen Schilderungen. Daher werden Quellen auch in Primär- und Sekundärquellen unterschieden, also solche, die direkt aus einer Zeit bzw. direkt vom Urheber stammen bzw. solche, die über etwas, bereits durch den Blickwinkel eines Beobachters, berichten.
Grundsätzlich ist Quellenkritik bei der Verwendung von Quellen wichtig. Daher muss die Art der Quelle berücksichtigt werden, und dabei stellt sich auch die Frage, was der Urheber der Quelle bezwecken wollte, welchen Standpunkt er vertrat und ob es auch andere wesentliche Standpunkte zu berücksichtigen gäbe. Ein Quellenvergleich und die Verwendung vieler unterschiedlicher Quellen werden am sichersten zu einem möglichst objektiven Bild führen.
Ritual (im religiösen Gebrauch: der Ritus) ist ursprünglich der durch Gesetz (geschrieben oder ungeschrieben) festgelegte Vollzug eines Kultaktes. Die Gesamtheit der Riten bildet das Ritual. Im übertragenen Sinne verwenden heute die Kultur- und Sozialwissenschaften den Begriff als präzisierte Verhaltensweisen in einem Handlungsrahmen. Ritual ist von lat. „ritus“ abgeleitet, es ist Brauch im Sinne eines präzis geformten und tradierten Verhaltensmusters (H. M. Wolf). Zum Ende des 20. Jahrhunderts wanderte der Begriff immer mehr in den profanen Bereich. Das ausgehende 20. Jahrhundert entwickelte – ausgehend von der großen Säkularisation und Differenziertheit der Gesellschaft – ein großes Bedürfnis nach neuen Ritualen für Situationen und Höhepunkte des Lebens, dem heute Agenturen, „master of ceremonies“ und Eventmanager nachkommen.
Sitte und Brauch: siehe Bräuche, siehe Brauchtum, Brauchtumspflege
Im Mittelalter war Kleidung kaum differenziert, erst im Hochmittelalter begann die Ausbildung von Standestrachten. „Tracht“ kennzeichnete bis ins 19. Jahrhundert Menschen nach sozialer und lokaler Herkunft. Ab ca. 1800 veränderte die städtische Saisonmode auch das Kleidungsverhalten auf dem Lande. Relikte ständischer Kleidung in stadtfernen Regionen wurden im 19. Jahrhundert als „Nationalcostume“ entdeckt. Aus ihnen entstand das, was wir heute als „Tracht“ bezeichnen. Diese „Trachten“ erlebten als Sommerfrischenmode ein zweites Dasein. In den 1930er-Jahren feierten solche Kreationen zwischen Romantik und Jugendstil Triumphe bei internationalen Modeschauen. Kurz nach 1900 entstanden die ersten Pflegebewegungen. Zu den Symbolen des Ständestaates gehörte der Trachtenanzug. Die NS-Zeit instrumentalisierte die „Vätertracht“ in der „Trachtenerneuerung“ für den „Volkstumskampf“. Trachten wurden im 19. Jahrhundert von Oberschicht und Unterschicht in verschiedener Form und aus unterschiedlichen Beweggründen getragen. Für Heimatschutz, Ständestaat und illegale Nazis waren die Kleider oft dieselben, die damit verbundenen Symbole aber andere. In der Wiederaufbauzeit nach 1945 war „Tracht“ Heimatsymbol der Österreicher, aber auch Mittel der Beschränkung auf knappe Ressourcen. In den 1960er-Jahren entstand eine an Kulturpolitik und Tourismus orientierte Bewegung der „Trachtenpflege und -erneuerung“, die Heimatwerke entwickelten eine Fülle von Regionaltrachten. Gleichzeitig eroberte der „Austrian Look“ erneut die internationale Modeszene. Kurse und Laienkreativität brachten Tracht in allen Facetten ins Bewusstsein. Die unbewältigte Trachtenvergangenheit, in Verbindung mit Geschichtsbewältigung und billigster Konfektion, zerstörte in den 1980er-Jahren den Ruf der österreichischen Trachtenmode im Inland wie im Ausland. Darauf antworteten viele Erzeuger Ende der 1980er-Jahre mit einem neuen Programm qualitätvoller Trachtenmode und kreativer Heimatkleidung.
Der Begriff „Tradition“ zeigt eine Überlieferung, mündliche Weitergabe an. Nach dem Zerfall des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation setzte in den deutschsprachigen Ländern, besonders in den fremdbeherrschten, eine Suche nach Traditionen und Nationalismen ein. Insgesamt ist das 19. Jahrhundert (vgl. Klassizismus und Historismus) eine Suche nach den eigenen Wurzeln, nach mehr Europäische Authentizität und Kreativität in einer gefügig gemachten Geschichte. Im 20. Jahrhundert wurde „Tradition“ zum Garanten von historischer Anbindung und schließlich zu einer Garantie nationaler Werte. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts verlagerte sich einerseits die Verwendung in kulturpolitische Bereiche und andererseits in eine kritische Debatte in den Wissenschaften. Vielfach ersetzte „Authentizität“ als persönlichkeitswirksames Erleben den Wert historischer Anbindung. „Indem die Volkskunde Traditionen fand, erfand sie diese zum Teil auch, sie selbst wurde zur Produzentin von Traditionalität“ (W. Kaschuba). Die vom Sozialhistoriker Eric Hobsbawm so benannte „invention of tradition“ zeigte das menschliche Bedürfnis nach Anbindung an Traditionen und die Wirkung ritualisierter Wiederholung als Stabilitätsfaktor von Gesellschafts- sowie Machtstrukturen auf.
Kurzfristige und schnelllebige Strömung als Handlungsmuster mit streng reglementierten Verhaltensweisen und standardisierten Objekten. Trends werden von Designern und Trendsettern vorgegeben und bedürfen der Medien für ihre Verbreitung. Trends dienen – ebenso wie andere Symbole und Normen – als Mittel der Distinktion, der Bildung und Unterscheidung von Gruppen sowie der Ausgrenzung, sie haben Wiedererkennungswert als Mittel der Kommunikation. Die sozialwissenschaftliche Trendanalyse vergleicht eine definierte Anzahl von Untersuchungsergebnissen zeitlicher Querschnitte.
Vereine: siehe Brauchtumsvereine
Der Begriff „Volk“ wird heute unterschiedlich definiert und ist im alltäglichen Gebrauch ein schwammiger; er bezeichnet heute u. a.:
im Sinne von Bevölkerung alle in einem abgrenzbaren Kulturgebiet oder Territorium lebenden Menschen;
im Sinne von Staatsvolk die Gesamtheit der Bevölkerung eines politischen Herrschaftsbereiches;
als ideelles bzw. politisches Konstrukt die Einheit einer politischen Kollektivpersönlichkeit mit einheitlich angenommenen Zielen;
eine spezielle ethnische Einheit von Menschen, der angebliche gemeinsame Merkmale zugeschrieben werden;
als soziale und hierarchische Wertung und Abgrenzung die breite Masse der „einfachen“, „untersten“ Bildungsschicht der Bevölkerung.
Im Laufe der letzten ca. 250 Jahre hat der Begriff immer wieder neue Inhaltszuschreibungen erlebt, die meist aus Konstrukten, Verallgemeinerungen oder Wunschvorstellungen einer Epoche entstanden sind. Der frühen Volkskunde und ihrer Begriffsbildung liegen – heute als unwissenschaftlich erkannte – romantische Vorstellungen zugrunde, dass Ethnien durch biologische Kräfte bestimmt wären, die spezielle soziale und intellektuelle Gesetzmäßigkeiten hervorrufen würden. Aus diesen Vorstellungen entstand die alte Ethnografie ebenso wie die frühe Völkerpsychologie. In Verbindung dieser Vorstellungen mit den frühen nationalistischen Strömungen des 19. Jahrhunderts entstanden die Vorläufer einer biologisch-rassistischen Volks- und Altertumskunde, die in den Verhaltensweisen bestimmter Ethnien das Fortwirken älterer völkischer Mythen wiederfinden wollte (Quellstrom- und Urquelltheorien). Diese Theorien sind in den Kulturwissenschaften gegenwärtig aufgegeben, heute werden Erziehung und Sozialisation in territorialen und sozialen Lebensräumen als prägend angesehen.
Salzburg stellt eine kulturelle Brücke zwischen dem bayerischen und innerösterreichischen Raum sowie einen Kulturtransformator (K. Conrad) von Süd nach Nord dar. Seine Alpenübergänge und inneralpinen Quer- und Längstäler waren wichtige Wege des Handels, der Kulturkontakte und der Migrationen. Auch die territoriale und politische Situation (bis 1803 reichsunmittelbares Fürstentum) war bedeutsam für die Ausbildung eigenständiger Kulturformen. Die besondere Bevölkerungsstruktur des geistlichen Fürstentums (geringe weltliche Beamtenschaft; Mangel einer Volluniversität; geringe, doch reiche Kaufmannschaft; privilegierte Bergleute) ergab andere Kulturbewegungen in der Bevölkerung als in Ländern mit ausgedehntem Beamtentum. Das kulturhistorische Netzwerk ließ viele regional- und lokaltypische Gestaltungsformen des Fest- und Alltagslebens der verschiedenen Gesellschaftsgruppen entstehen. Die Pflegebestrebungen seit dem 19. Jahrhundert sowie die kulturpolitischen Anliegen im 20. Jahrhundert ließen das, was heute als „Salzburger Volkskultur“ bezeichnet wird, entstehen. Siehe Bräuche, siehe Brauchtum, Brauchtumspflege.
Bis ins 18. Jahrhundert wurde „künstlich“ im Sinne von „kunstvoll“ – handwerkliches Können, ästhetischer Anspruch – verwendet. Heute ist der Begriff zur negativen Wertung von „unwahr“ oder „unecht“ (siehe Authentizität) abgesunken, dagegen bekam der Begriff „Kunst“ gesellschaftliche Relevanz. Seit dem 17. Jahrhundert separierten sich Kunst und Handwerk. Das führte im 18. Jahrhundert zu einer Unterteilung der Sparten nach den Herstellern, was soziale und finanzielle Bewertungen und neue Begriffe zur Folge hatte. Der Begriff „Hochkunst“ bildete sich im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts als Qualitäts- und Unterscheidungskriterium heraus, er ist weniger Sachgruppenzuweisung als Wertung für die elitäre Kunst einer Oberschicht, die am Wissen und an der Ästhetik der Zeit orientiert war. Als Abgrenzung von Kategorien entstanden die Begriffe „Kunstgewerbe“, daraus „Volkskunst“, im frühen 20. Jahrhundert „Massenkunst“ (Industrieprodukte) sowie „Kitsch“ als inhaltliche sowie handwerkliche Abwertung. Während die älteren Begriffe „Hausgewerbe“, „Handwerk“ oder „Manufakturprodukt“ u. a. nur die Erzeugungsform benennen, enthalten die jüngeren, obigen Begriffe bereits Wertungen und Relationen. Die Moderne arbeitet mit einem pluralistischen Kunstbegriff. Die „Entdeckung“, Sammlung und Bewertung von Volkskunst ging von handwerklichen Vorbildsammlungen aus, zu ihrer Bewertung entstanden „Kriterienkataloge“, die keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhalten (L. Kriss-Rettenbeck). In den 1950er-Jahren begann, von Arnold Hauser ausgehend, die Soziologie der Kunstbetrachtung, die zu den Konsumtions- und Kommunikationstheorien führte, Kunst also als gesellschaftliche Signale (E. Schwedt) einer schichtenspezifischen, temporären Ästhetik (N.-A. Bringéus) verstand. Heute wird der Begriff „Volkskunst“ für jene Erzeugnisse vorindustrieller Zeit verwendet, die im 19. Jahrhundert gesammelt und musealisiert worden sind (F. J. Grieshofer).
Siehe Bräuche, siehe Brauchtum, Brauchtumspflege.
Volksmusik, Volkslied und Volkstanz werden heute von der Musikwissenschaft als Gattungen behandelt. Dagegen geht die Europäische Ethnologie vom Begriff „Popularmusik“ aus und versteht darunter jegliche populäre Musik, allein nach der Bewertung und Verwendung im Alltag von Gruppen. Das Genre „Volksmusik“ umfasst überall auf der Welt elementare Ausdrucksformen (Spiellieder der Kinder, Arbeitsrufe, Lärmgeräte, primitive Musikinstrumente) bis zu hochstilisierten Liedern und Tänzen, also eine Vielzahl an Gattungen und Typen, die improvisatorisch überliefert sind und zum Gemeinschaftsleben gehören. Auch im Lebens- und Wirtschaftsraum der Alpen hat sich eine typische, von Bergbauern-, Alm- und Hirtenkultur geprägte Musik entwickelt. Diese „Produktive Naturhaftigkeit“ wurde „geschichtlich erworben und verloren“ und erlebte eine typische „alpenländische Einengung und Weiterbildung“ (W. Wiora). Vom späten Mittelalter an färbte das Vorbild der Residenzstädte auf die Musik und Tänze der Handwerker ab. Ende des 18. Jahrhunderts schuf die Ausstrahlung der „Wiener Klassik“ ein musikalisches Zentrum am Alpenostrand, das u. a. das Salzkammergut (Instrumentierung der Schrammelmusik) prägte. Johann Gottfried Herder gilt weithin als der Entdecker des „Volksliedes“ – daher wurde unter Volksmusik lange nur das Lied verstanden. So teilte Lorenz Hübner 1796 auch die salzburgischen Volkslieder nach dem Verwendungszweck in „Schnodahüpfl“, Gasselreime, geistliche Gesänge und Lieder zu Erotik, Wildschießen, Alpenleben und Soldatenleben ein. Am Vorbild der napoleonischen Volksmusikumfrage entstand in Österreich ab 1819 eine Volksmusiksammlung, die auf die Überlieferung zurückwirkte. Joseph Sonnleithner leitete 1819 über die „Gesellschaft der Musikfreunde in Wien“ eine Umfrage bei Lehrern und Geistlichen ein (Österreichische Volkslieder und ihre Singweisen. Budapest 1819.) Der Salzburger Teil der Sonnleithner-Sammlung zeigt im Vergleich zu den „Salzburgische(n) Volkslieder(n) mit ihren Singweisen“ von Vinzenz Maria Süß, 1865 (Th. Hochradner), einen raschen Wandel auf. Süß zeichnete unzensuriert und ungeschönt die Texte der Lieder vor Einführung des Musikunterrichtes in den Schulen (Reichsvolksschulgesetz 1869) auf. Die Schule (Volkslied und Geige erhielten Vorrang vor Kirchenlied und Orgel) wurde wesentlicher Musikvermittler. Die systematische Volksmusikforschung und -pflege, ausgehend von Josef Pommer 1884, führte zum heutigen Repertoire und der Institution „Volksliedwerk“. 1884 gab Pommer das „Liederbuch für die Deutschen in Österreich“ heraus, 1889 gründete er den „Deutschen Volksgesangs-Verein“, der als erster Frauen aufnahm, 1899 gab er „Das deutsche Volkslied“ als erstes Fachblatt heraus. Pommer ging von einer Produktionstheorie aus, er sammelte „vom Volke ersonnene“ Lieder. Heute sind Reproduktions- und Konsumtionstheorien bedeutender. 1904 Gründung des „Unternehmens Volkslied in Österreich“, ab 1914 als „Österreichisches Volksliedunternehmen“ beim Ministerium für Kultus und Unterricht, ab 1905 Errichtung von Arbeitsausschüssen in den Kronländern. 1906 wurde ein Arbeitsausschuss für das Volkslied in Oberösterreich und Salzburg gegründet, 1908 der Salzburger Arbeitsausschuss unter Josef Reiter. In der achtbändigen „Kleinen Quellenausgabe“ erschien als Band 7, 1933, „Salzburgische Bauernlieder“ von Otto Eberhard und Curt Rotter. Von 1938 bis 45 Umbenennung in „Ostmärkisches Volksliedunternehmen“ unter NS-Vorgaben unter Cesar Bresgen und Otto Eberhard. 1945 wurde das Archiv bombardiert. 1946 Neubegründung als „Österreichisches Volksliedwerk“, als Kommission beim Bundesministerium für Unterricht, mit Bundesländer-Ausschüssen. Die Ansprüche folgten jenen der Frühzeit: Aufzeichnen, Forschen, Bilden. 1974 Umwandlung in „Dachverband der Bundesländer“, dessen Zentralarchiv seit 1994 Teil der Österreichischen Nationalbibliothek ist (G. Haid).
Volksmusik ist als Begleitmusik – Lärm- und Klangkörper, Musikinstrumente, Geleitformationen, Tanz und Lied – Bestandteil vieler Bräuche, sie gehört zur Klangökologie von Zeit- und Landschaftsräumen. Lieder sind oft psychisches und soziales Ventil, sie kritisieren die Diskrepanz von Recht und Gerechtigkeit bzw. Bedürfnis und Realität. In ihnen werden Auseinandersetzungen ausgetragen, erotische Sehnsüchte artikuliert, sie enthalten Grobheiten, Zynismus und Situationskomik. Sie sind ein „Spiel hinter dem Spiel“, das die Realität gleichzeitig trifft und aufhebt (G. Haid). In der NS-Zeit wurde Volksmusik geschönt und mit einem ernsten Tenor bedacht. Damit gingen die Elemente von Kontrolle, Sozialkritik, Interaktion und Witz verloren. In der traditionellen Ständegesellschaft waren die Musikstile der Gesellschaftsgruppen stärker differenziert, doch fand eine stete Orientierung an zeitgenössischen Entwicklungen statt.
Der in Österreich geprägte Stilbegriff der „alpenländischen Volksmusik“ (Dreiklangmelodik im Dreiertakt, große Tonumfänge, Mehrstimmigkeit) wird nur im süddeutsch-österreichischen Raum verwendet und charakterisiert die vom Berner Oberland bis Slowenien verbreitete Ländler- und Jodlerkultur. Sie wurde mitgeprägt von Gruppen und Zeitströmungen, wie z. B. den Nationalsängern des 19. Jahrhunderts u. a. (W. Suppan). Dieser Stil zeigt vielfältige Facetten von traditionsgeprägter Innovation (z. B. Dreigesang, Volksliedchöre) bis zur kommerziellen Ausbeutung. Instrumentalmusik (immer als Begleitung einer Aktivität) und Tanz waren Mittel der Kommunikation. Wandernde Musikanten zogen in fixen Routen von Fest zu Fest, Musik war ihr Nebenerwerb. Das Repertoire war zeit-, anlass- und publikumsspezifisch. Seit dem 19. Jahrhundert griffen Bewertung und Auswahl von Pflege und Vereinen ein. Prägend waren auch Innovationen, etwa die konzertant aufgeführte „Stubenmusik“ oder das „Salzburger Adventsingen“ von Tobi Reiser d. Ä.
Auch der Volkstanz entstand im Wechselspiel zum Tanz anderer Gesellschaftsgruppen. In den Oberschichten war um 1700 das Menuett prägend, in den Unterschichten die Hüpf- und Drehtänze. Ende des 18. Jahrhunderts drangen die Volkstänze in die Oberschicht vor („engl. Hopser“, Dreher, Schleifer, Allemande) und wurden als „National- und Bauerntänze der Völker“ aufgezeichnet. Sie führten zur Entwicklung von Landler/Ländler, Polka, Bayrischem und Walzer (der Revolution des Paartanzens der Oberschichten). Diese neuen Formen erhielten sich in der Volksmusik der Alpentäler bis heute. Seit 1900 kam es zur Fixierung und Stilisierung der Figuren und Schritte. Neben dem geselligen Tanz, der im steten Austausch mit Tänzen anderer Gesellschaftsgruppen stand, erhielten sich über Fest und Brauch ältere Reigentänze (Reif- und Bandeltänze der Handwerker aus dem 15. Jahrhundert). Diese verschwanden im 18. Jahrhundert, wurden aber durch die Altertums- und Pflegebewegungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts neu bewertet, erneuert und gepflegt. Der gesamte Lebenszusammenhang von Musikstücken wird heute durch Feldforschung dokumentiert. Durch Volksmusikpflege und Vereine kam es einerseits zur Ausbildung konservierender und perpetuierender geschlossener Systeme und andererseits zu breitenwirksamen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie zur Hebung des technischen und musikalischen Niveaus (G. Haid).
Vorläufer der Volkskunde entstanden in Österreich in der Aufklärung. Das Wort findet sich 1813 in Johann Felix Knaffls staatlicher „Statistik“ als zweiter Begriff für diese. 1846 wurde der Begriff „Volkskunde“ aus dem englischen „folklore“, im Sinne von „Wissen des Volkes“ übernommen (L. Schmidt). Diese romantisch-nationale Altertumskunde, gepaart mit sozioökonomischen Interessen rund um die Wiener Weltausstellung von 1873 sowie mit der Suche nach den Ursprüngen der Kunst im Historismus, ergab um 1900 die frühe Volkskunde. „Altertümliche Phänomene“ wie Lied und Märchen, Haus und Gerät, Volkskunst und Volkstracht bildeten den „volkskundlichen Kanon“. Zwischen 1880 und 1930 entstanden verschiedene Sparten der Alltagswissenschaften, der Mensch wurde interessant. Kulturpolitische und volksbildnerische Interessen verbanden sich mit dem Fach (u. a.: Heimatschutz, NS-Zeit), prägten die Begriffsbildung und die Bereiche bzw. instrumentalisierten es. Auch kulturpessimistische und ethnische Interessen waren damit verbunden. In Deutschland begann die kritische Auseinandersetzung mit der Fachgeschichte und die Suche nach wissenschaftlichen Theorien und Methoden in den 1950er-Jahren, Österreich zog sukzessive nach. Heute versteht sich Volkskunde als integrative Kulturwissenschaft, die in engem Kontakt zu den Geistes- und Sozialwissenschaften steht. Seit der Positionierung als Europäische Ethnologie/Vergleichende Kulturwissenschaft erwies sich der alte „Kanon“ als unwissenschaftliches Konstrukt und vorbewertete Auswahl. Nicht die „Relikte“ und „Altertümer“ der als bäuerlich und überliefert klassifizierten Lebensformen stehen im Forschungsinteresse, sondern die Lebensraumforschung und der Mensch als handelndes Subjekt. Volkskunde ist synchrone Kulturgeschichtsschreibung, multiperspektivische Ethnologie der Umgangsweisen, die Wissenschaft vom Leben der Menschen in soziokulturellen Prozessen, von Menschen als Überlieferern und Neugestaltern ihrer Kultur. Sie fragt nach der Entstehung kultureller Äußerungen und deren Verbreitung, Wandlung und Veränderung. Sie erforscht alle Arten der Aneignung, Umformung und Verarbeitung von Kultur nach der Notwendigkeit einzelner Gruppen, Regionen und Ethnien.
Um die Einführung einer wissenschaftlichen Volkskunde in Salzburg erwarb sich die Katholische Fakultät der Universität große Verdienste, die 1934 mit Unterstützung des „Notringes der Deutschen Wissenschaften“ ein „Institut für religiöse Volkskunde“ begründete, dessen Leiter Hanns Koren wurde. Das Institut wurde 1938 vom NS-Regime gesperrt und geplündert. Koren verfasste dort seine beiden programmatischen Schriften, in denen er gegen eine nationale Instrumentalisierung und geschichtslose Mythisierung der Volkskunde und ihrer Forschungsbereiche auftrat und auf die prägende Funktion der katholischen Kirche auf volkstümliche Alltagswelt, Lebensgestaltung und Weltanschauung hinwies. Von 1938 bis 1945 bestanden verschiedene Forschungsinstitutionen des NS-Regimes (dem sogenannten „Amt Rosenberg“ des Reichsleiters Alfred Rosenberg sowie dem „Ahnenerbe der SS Heinrich Himmler“ zugehörig) in Salzburg, die aus heutiger Sicht aber nicht Wissenschaft, sondern Kulturpolitik betrieben. Sie arbeiteten all jenen Vereinigungen zu, die die Bevölkerung erfassten und im Sinne des Regimes fortbildeten und indoktrinierten. Nach 1945 existierte Volkskunde als Wissenschaft in Salzburg nicht mehr. Erst 1983 wurde das „Salzburger Landesinstitut für Volkskunde“ begründet. Es ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Salzburg.
Weltbilder und Weltanschauungssysteme haben eine dreifache Wirkung: Sie informieren, sie rufen eine affektive Beziehung zu bestimmten Gegebenheiten hervor, die für das Leben bedeutsam sind und sie bewirken eine bestimmte Motivation mit einem entsprechenden Verhalten. Weltbilder entspringen religiösen, politischen sowie zeitspezifischen Grundvoraussetzungen. Aus ihnen entsteht ein großer Handlungsrahmen, der in Handlungsanleitungen und konkrete Normen, Sitten, Rituale, Bräuche, Symbole etc. (H.-G. Soeffner) zerfällt.
Bezeichnung der Geschichtsphilosophie und der Kultursoziologie für die spezifischen Inhalte, den Sinnzusammenhang und das Problembewusstsein der besonderen Leistungen bestimmter kultureller Persönlichkeiten, Gruppen oder Epochen. Zeitgeist wird auch für die bei der Mehrzahl der Zeitgenossen eines Zeitraumes vorherrschenden soziokulturellen Werthaltungen, Denkstile und Vorlieben verwendet. Zeitgeist wird oft als Ausdruck der Kultur von Gruppen (Elite wie Massenkulturen) untersucht.